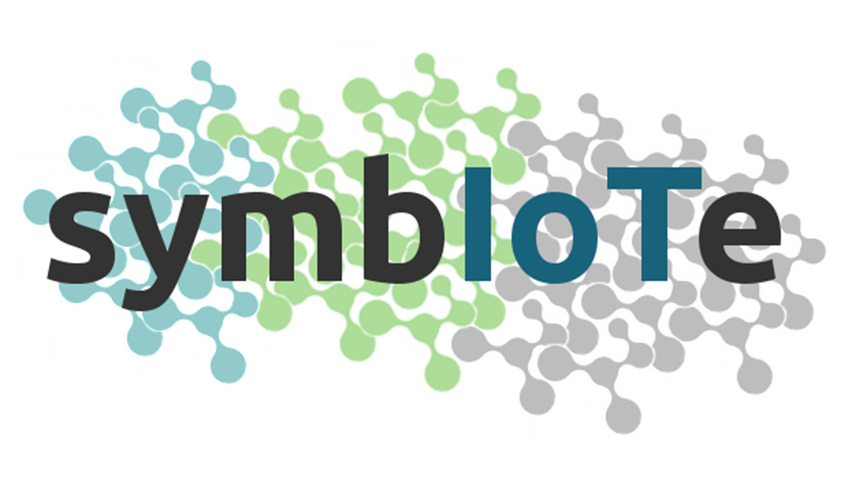Vom "Internet of Things" zum "Internet of People"
| 30. Januar 2017
Peter Reichl und sein aktuelles Handy: "Technologie ist für mich etwas Wunderbares. In meinem Leben gibt es aber immer noch kein Smartphone oder Facebook." (Foto: Universität Wien)
Der Siegeszug des Internets brachte viele Vorteile, aber auch gravierende Gefahren. Informatiker Peter Reichl von der Universität Wien plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit Technologie und erklärt, warum es kein Internet für Dinge, sondern ein Internet für Menschen braucht.
uni:view: Herr Reichl, angefangen hat das Projekt "Internet" am 29. Oktober 1969 als einfache Verbindung zwischen zwei Computern der UCLA und dem Stanford Research Center. Wie sehen Sie als Informatiker die unglaublich rasante Entwicklung dieser Technologie, die heute ein fester Bestandteil des Alltags geworden ist?
Peter Reichl: Das Internet geht ursprünglich auf eine Idee des US-Verteidigungsministeriums zurück, das ein ausfallsicheres Datennetz konstruieren wollte. Aus diesem Ursprung heraus ist das Netz dann lange Zeit innerhalb der Wissenschaft genutzt worden, um sich gegenseitig auszutauschen. Anfang der 1990er Jahre kam dann der große Umschwung mit der Erfindung des World Wide Web, der dazu geführt hat, dass aus dem Netz eine globale Infrastruktur wurde, die heute für das Funktionieren unserer Welt von fundamentaler Bedeutung ist. Die Geschwindigkeit, mit der dieser Wandel geschehen ist, ist unglaublich, manchmal allerdings auch erschreckend.
uni:view: Was meinen Sie damit genau, was erschreckt Sie daran?
Reichl: Bei der Entwicklung des Internets können wir tatsächlich von einem exponentiellen Wachstum sprechen. Ein derartiges Wachstum überschlägt sich irgendwann selbst. Ich habe das Gefühl, dass wir genau in einen solchen Zustand hineinlaufen: Der Mensch kann mit diesem technologischen Fortschritt schlichtweg nicht mehr Schritt halten. Das Wachstum des Internets ähnelt inzwischen einem gigantischen Tsunami, dessen gesamtgesellschaftliche Konsequenzen kaum mehr überschaubar, geschweige denn beherrschbar scheinen.
uni:view: Sie befürchten also, dass uns die Entwicklung aus den Händen gleiten könnte?
Reichl: Bis vor einigen Jahren hatte man die Angelegenheit noch einigermaßen im Griff und es standen die positiven Aspekte im Zentrum: Wie können wir diese wunderbare Infrastruktur nutzen, die uns alle rund um den Globus verbindet und irgendwie "sozialer" macht. Negative Aspekte wie Datenschutz oder Sicherheit wurden dabei oft eher als Kollateralschäden betrachtet. Diese Situation scheint sich mittlerweile aber umzukehren: Das, was wir heute sehen, ist vielleicht nurmehr der "Kollateralnutzen", den das Netz bietet. Und zwar ein Netz, das mittlerweile auf dem Weg ist, sich zu verselbständigen, und bei dem es extrem schwierig werden wird, die Entwicklung wieder einzufangen.
uni:view: Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte es also sein, dass das Internet uns in Wirklichkeit mehr schadet als nützt?
Reichl: Wenn es um das Internet geht, sehen die meisten Menschen zuallererst ihre individuellen, momentanen und daher überschaubar scheinenden Vorteile, und vergessen leicht darauf, Nutzen und Risiken global und langfristig gegeneinander abzuwägen. Plakativ formuliert: Wir verhalten uns wie Lemminge, die den Dingen blind hinterherlaufen, nur weil sie blinken und bunt sind. Stichwort "Pokémon Go": Da brauche ich also Monster in einer halbvirtuellen Welt, damit ich die Leute dazu bewegen kann, wieder etwas Zeit an der frischen Luft zu verbringen? Und dass diese Handy-App dabei massenhaft persönliche Daten über ihre NutzerInnen sammelt, ist den meisten schlichtweg egal oder gar nicht bewusst. Für mich ist das erschütternd zu beobachten. Oder ein anderes Beispiel: Vor kurzem wurden rund 500 Mio. Nutzerdaten von Yahoo gestohlen – eine halbe Milliarde Konten! Und es war gerade einmal zwei Tage lang eine Pressemeldung wert… Solche Datendiebstähle sind heute kein Einzelfall, sondern passieren laufend. Der große Aufschrei ist allerdings ausgeblieben, und ich frage mich, was noch alles passieren muss, bis die Menschen endlich aufwachen.
uni:view: Mit dem Internet der Dinge kommt bereits die nächste Entwicklungsstufe der Vernetzung auf uns zu. Laut einer aktuellen Prognose soll es schon 2022 rund 14 Mrd. Geräte weltweit geben, die mit dem Web verbunden sind. Woran denken Sie, wenn Sie das hören?
Reichl: Diese Prognose kommt mir in Anbetracht der jüngsten Entwicklung sogar recht niedrig angesetzt vor. Das könnten bis dahin auch deutlich mehr Geräte sein. Mich regt das an, darüber nachzudenken, ob nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür wäre, alles noch einmal kritisch zu hinterfragen: Ist es wirklich sinnvoll, mit viel Geld eine Infrastruktur aufzubauen, um Waschmaschinen und Kühlschränke mit Toastern und Straßenlaternen kommunizieren zu lassen? Ist dieser Ansatz des Internet der Dinge, bei dem der Mensch mehr oder weniger ausgeblendet scheint, wirklich der richtige?
1. Open Call zum EU-Projekt "symbIoTe"
Mit der Forschungsgruppe "Cooperative Systems" nimmt Peter Reichl als einer von zwei Partnern aus Österreich an dem im Rahmen des Horizon 2020-Programmes der EU geförderten Projekts "symbIoTe" teil. Das Konsortium besteht aus 14 Institutionen und Firmen aus acht verschiedenen EU-Ländern. Ziel ist es, einheitliche Standards und sichere Zugänge zu IoT-Ressourcen zu etablieren.
Wer kann sich bewerben? IoT-Plattformen, die bevorzugt symbIoTe-kompatibel werden möchten.
Bis wann kann man sich bewerben? Bis zum 28. Februar 2017.
uni:view: Sie haben gewissermaßen ein Gegenkonzept zum Internet der Dinge entworfen, das Sie als "Internet of People" bezeichnen. Was ist darunter zu verstehen?
Reichl: Wir sind gerade dabei, unser Konzept zu konkretisieren. Im Prinzip plädieren wir mit der Idee eines Internet of People für einen grundlegenden Paradigmenwechsel in den Informations- und Kommunikationstechnologien, den ich auch als "Anti-kopernikanische Wende" bezeichne. Damit ist gemeint, dass Technologie nicht mehr Selbstzweck sein soll, sondern nur für die EndnutzerInnen da sein muss, um sie bei der Erfüllung ihrer wirklichen Bedürfnisse zu unterstützen. Noch plakativer formuliert: Statt weiterhin um Technologie und ihre Versprechungen zu kreisen, bis ihm schwindlig wird, kehrt der Mensch zurück ins Zentrum des technologischen Universums.
uni:view: Das klingt auf den ersten Blick sehr abstrakt. Können Sie das konkretisieren?
Reichl: Für uns bedeutet das, dass Technologie nicht entwickelt wird, um Dinge mit Dingen zu verbinden, sondern Menschen mit Menschen. Für die konkrete Umsetzung dieses Ansatzes haben wir verschiedene Ideen. Zum Beispiel wäre es denkbar, das Handy stärker als Spiegel seines/r NutzerIn zu begreifen und nicht alles mit einem einheitlichen Standard zu lösen, sondern viel individueller auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen. Ein anderes Beispiel betrifft die sogenannte "Quality of Experience", bei der es darum geht, möglichst subjektiv nutzerfreundliche Angebote zu schaffen. Die letzten 30 Jahre lang wurde Netzqualität über abstrakte technische Parameter wie Bandbreite oder Paketverlustrate definiert. Wir versuchen, das auf den Menschen herunter zu brechen, und wollen Qualität danach bemessen, wie sie "im Auge des Betrachters" ankommt.
uni:view: Wie finden Sie heraus, wie ein bestimmter Webservice bei seinen NutzerInnen ankommt?
Reichl: Dafür führen wir beispielsweise Experimente mit repräsentativen Endnutzern in unserem Labor durch und konfrontieren Leute mit verschiedenen Angeboten unterschiedlicher Qualität. Die Einblicke, die wir dadurch gewinnen, können dann in weiterer Folge beispielsweise bei einem Internet Service Provider genutzt werden, um ein besonders userfreundliches Angebot zu schaffen, das sich von der Konkurrenz abhebt.
uni:view: Was braucht es, um die von Ihnen postulierte "Anti-kopernikanische Wende" herbeizuführen?
Reichl: Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, die nicht so leicht zu bewerkstelligen sein wird. Was es auf alle Fälle braucht, ist ein sehr breit angelegter kritischer Diskurs, der bereits in der Schule anfängt. Dabei meine ich nicht nur das Vermitteln von digitalen Kompetenzen, sondern vor allem auch eine grundlegende Diskussion darüber, wie diese neue informationsgetriebene Umwelt mit der menschlichen Lebenswelt zusammenhängt. Das betrifft viele verschiedene Fächer. Dabei muss man den Menschen – Kindern wie Erwachsenen – viel mehr über die Hintergründe der Technologie nahebringen und sich nicht nur auf rein funktionale Aspekte – wie bediene ich dieses oder jenes Tool – beschränken.
uni:view: Was kann die Wissenschaft bzw. die Informatik dazu beitragen?
Reichl: Die Wissenschaft muss zu allererst einmal ehrlich zu sich selbst sein und versuchen, in einer ruhigen Minute einen Schritt zurück zu treten, um die gesellschaftlichen Auswirkungen ihres Tuns – und Lassens – kritisch zu hinterfragen. Die Semesterfrage der Universität Wien ist ein sehr gutes Beispiel, wie sich das praktisch umsetzen lässt. Von der Politik dürfen wir uns solche fundamentalen Überlegungen nicht erwarten. Und die Medien springen oft erst dann auf den Zug auf, wenn es Quote bringt.
Gerade die Informatik muss sich als Fach viel stärker in die Pflicht nehmen und reflektieren, was man da eigentlich tut und was das bedeutet. Ihr geht es heute genauso wie der Physik mit der Atombombe oder der Biologie mit dem ersten Klonschaf: Im Zuge des digitalen Wandels sind wir momentan dabei, eine entscheidende Grenze zu überschreiten. Diese Entwicklung muss von einer kritischen Diskussion begleitet werden. Wenn wir die Grenze einmal überschritten haben, ist es zu spät zum Einlenken. Bei der Atombombe haben sich auch viele später gedacht: Mist, hätten wir da nicht eigentlich schon früher den Stecker ziehen müssen? Es ist allerhöchste Zeit für einen kritischen Aufschrei – auch und vor allem aus der Informatik heraus.
uni:view: Wie kommt Ihre Idee des Internet of People bei Ihren KollegInnen an?
Reichl: Im persönlichen Gespräch bin ich oft überrascht, dass die Problematik an sich von sehr vielen KollegInnen ähnlich wahrgenommen wird. Allerdings macht kaum jemand öffentlich den Mund auf, um darauf hinzuweisen, dass wir dabei sind, die Büchse der Pandora zu öffnen. Ich kann schon verstehen, dass man als InformatikerIn eher davor zurückschreckt, da man damit ja in gewisser Weise an dem Karriereast sägt, auf dem man sitzt. Dennoch halte ich es für ungemein wichtig, dass gerade aus unserer Disziplin heraus versucht wird, eine kritische Diskussion anzustoßen.
uni:view: Was passiert, wenn die Büchse der Pandora trotzdem geöffnet wird?
Reichl: Wenn wir die technologische Entwicklung weiterhin ungebremst und unkritisch vorantreiben und es keine Rückwendung hin zum Menschen gibt, laufen wir Gefahr, letzten Endes überflüssig zu werden bzw. unsere eigene Existenz zu bedrohen. Transhumanisten wie der schwedische Philosoph Nick Bostrom gehen davon aus, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre einen Punkt erreichen werden, an dem es zu einem Quantensprung kommen wird. Dann könnte eine künstliche "Superintelligenz" als Folge ihrer riesigen Überlegenheit über jegliches menschliche Denken zur unmittelbaren Gefahr für den Fortbestand der Menschheit, wie wir sie kennen, werden. Ist dieser Punkt einmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Der Zeitpunkt des Handelns ist also jetzt. Wir müssen so schnell wie möglich damit anfangen, über Antworten nachzudenken und uns überlegen, ob man nicht irgendwo einen Stecker einbauen sollte, den man im Notfall noch ziehen kann. Und das muss jetzt geschehen – solange wir es noch in der Hand haben.
uni:view: Zum Abschluss würden wir gerne Ihre Antwort auf unsere Semesterfrage hören: Wie leben wir in der digitalen Zukunft?
Reichl: Als Menschen werden wir auch weiterhin in einer analogen Gegenwart leben, da wir ja gar nicht anders können: Das ist unsere conditio humana, und keine Maschine wird es uns jemals abnehmen, auf die fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz unsere ganz persönliche Antwort finden zu müssen.
Die Frage ist eher: Wie können wir Mensch bleiben in einer zukünftig digital dominierten Umwelt? Dass letztere sowohl Chancen als auch Risiken birgt, ist längst zum Gemeinplatz geworden, aber: Der Grat dazwischen ist schmal und steil, und hier die Balance zu halten, wird alles andere als eine leichte Aufgabe – für das Individuum wie für die Gesellschaft.
Retten kann und wird uns die Hinwendung zu einem "digitalen Humanismus", der sich wieder auf die Wurzeln unseres Daseins besinnt, und sich vor diesem Hintergrund den Möglichkeiten neuer digitaler Technologie öffnet, solange diese für den Menschen da ist. Wir müssen aber auch bereit sein, darauf zu verzichten, wo dies nicht mehr der Fall ist. Tun wir dies nicht, so droht uns rasch der Rückfall in eine neue "selbstverschuldete Unmündigkeit", wie wir sie seit Kant überwunden zu haben glaubten. Noch liegt die Entscheidung in unserer Hand – wir müssen sie aber treffen.
uni:view: Danke für das Gespräch! (ms)
Jedes Semester stellt die Universität Wien ihren WissenschafterInnen eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft aktuell bewegt. In Interviews und Gastbeiträgen liefern die ForscherInnen vielfältige Blickwinkel und Lösungsvorschläge aus ihrem jeweiligen Fachbereich. Die Semesterfrage im Wintersemester 2016 lautete "Wie leben wir in der digitalen Zukunft?". Zur Semesterfrage 2016/17
Mehr über Peter Reichl:
Univ.-Prof. Dr. Peter Reichl ist Leiter der Forschungsgruppe Cooperative Systems (COSY) und beschäftigt sich vorwiegend mit Telekommunikationsnetzen und -applikationen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Nutzerperspektive von Kommunikationstechnologie und damit zusammenhängende ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Fragestellungen.