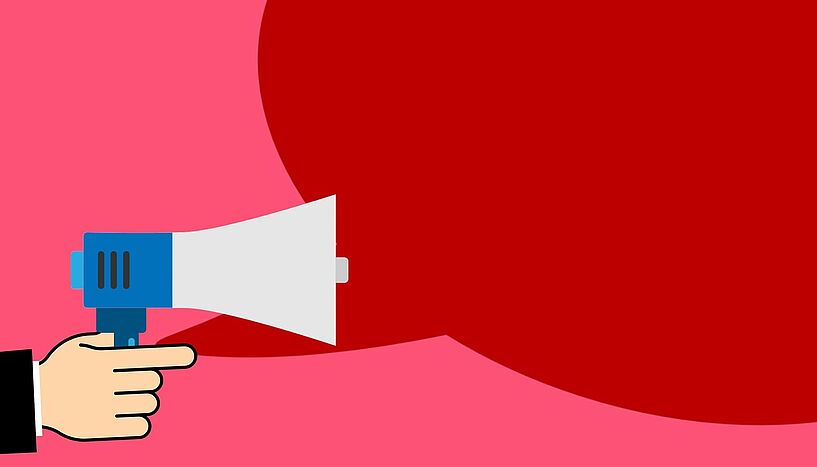Erleben wir eine Renaissance der Solidarität?
| 01. April 2020
In der aktuellen Krise wird "Daheimbleiben" gefordert, um vulnerable Gruppen zu schützen – ist das gelebte Solidarität? (© Fevstiforova/pixabay)
Solidaritätsbekundungen oder Aufrufe zum solidarischen #stayhome: Wie die Renaissance der Solidarität unter COVID-19 zu deuten ist und in der Praxis umgesetzt wird, besprechen Katharina T. Paul und Katharina Kieslich vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien.
Solidarität ist die Bereitschaft, soziale, zeitliche oder finanzielle Kosten auf sich zu nehmen, um jenen zu helfen, mit denen man sich in irgendeiner Form verbunden fühlt. So lautet die Definition von Barbara Prainsack, Leiterin der Uni Wien-Forschungsgruppe "Zeitgenössische Solidaritätsstudien" (CeSCoS), und Alena Buyx (TU München) in ihrem gemeinsamen Buch zur Bedeutung und Ausgestaltung der Solidarität im Gesundheitsbereich und in der Biomedizin. In der aktuellen Krise nehmen wir z. B. durch das viel geforderte "Daheimbleiben" die Kosten von langen Tagen in Kauf, in denen Homeoffice, familiäre Verpflichtungen und Kinderbetreuung zu Hause unter einen Hut gebracht werden müssen. Ist es richtig, diese Praxis als gelebte Solidarität zu bezeichnen, wenn sie von Regierungen weltweit nicht nur gefordert, sondern mittlerweile auch durch Polizeikontrollen gegen den Willen der Menschen durchgesetzt werden kann?
"Solidarität bietet neue Lösungsstrategien für einige der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen": Die Forschungsgruppe "Zeitgenössische Solidaritätsstudien" (CeSCoS) am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien erforscht unter der Leitung von Barbara Prainsack Solidarität in Forschung und Praxis.
Über die Pflicht hinaus
Hier hilft ein Blick auf die Handlungen, die Menschen derzeit abseits von den Regierungsmaßnahmen unternehmen, um andere zu schützen oder zu unterstützen. Empirisch wissen wir darüber bisher noch sehr wenig, aber uns allen sind Beispiele aus den Medien und unserem Umfeld bekannt: Familien und Freunde, sowie Pädagog*innen, welche Kinder betreuen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Denn so können diese Mütter und Väter weiterarbeiten und dabei sich, ihre Patient*innen und ihr Umfeld schützen.
Nachbar*innen, die Einkaufshilfen organisieren, um älteren Mitmenschen das "Daheimbleiben" zu ermöglichen. Menschen, die – außer im Notfall – Ordinationen nicht aufsuchen, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten und Ärzt*innen die Möglichkeit zu geben, Vorbereitungen für einen Anstieg von COVID-19-Patient*innen zu treffen.
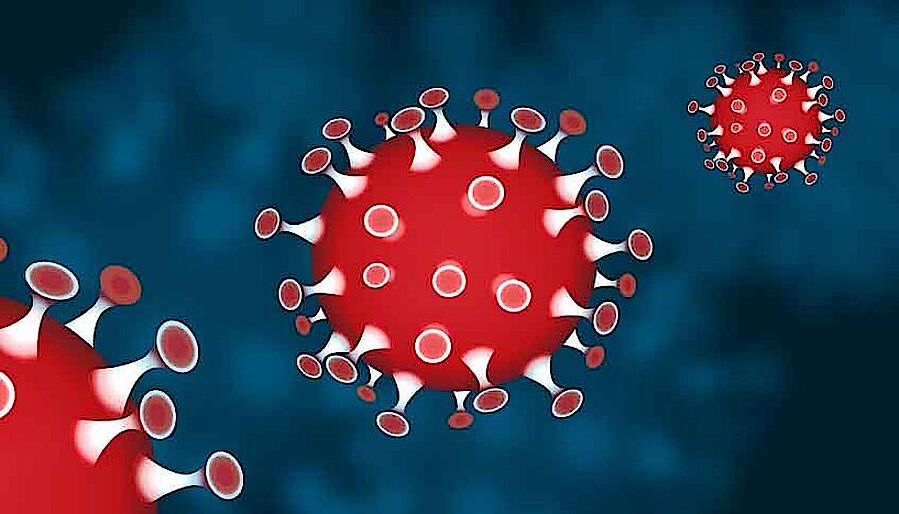
Coronavirus: Wie es unser Leben verändert
Von neuen familiären Abläufen bis hin zu den Auswirkungen auf Logistikketten: Expert*innen der Universität Wien sprechen über die Konsequenzen des Coronavirus in den unterschiedlichsten Bereichen.
Zum Corona-Dossier
Solidarisch – aber wem gegenüber?
All diese Beispiele können gelebte Solidaritätspraktiken sein. Derzeit arbeiten wir in unserer Forschungsgruppe an einem neuen Projekt, um durch virtuelle Interviews und Fokusgruppen in unterschiedlichen Ländern (Österreich, Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich) herauszufinden, was Menschen über die Regierungsmaßnahmen hinaus tun, um anderen zu helfen.
Wir möchten systematisch erforschen, wem gegenüber sich Personen in diesen schweren Zeiten solidarisch zeigen (oder auch nicht), und welche Faktoren für dieses Verhalten entscheidend sind. Denn Solidarität verlangt auch, dass wir mit bestimmten Gruppen Gemeinsamkeiten erkennen, die uns dazu motivieren, solidarisch zu handeln. Dieses "Erkennen von Gemeinsamkeiten" erklärt vielleicht auch, warum wir so wenig darüber lesen, wie Alleinerziehende, Wohnungslose, einsame oder psychisch erkrankte Menschen, Menschen in kleinen Wohnungen oder geflüchtete Mitbürger*innen die derzeitige Situation erleben.
Beispiele von Solidarität gegenüber diesen vulnerablen Gruppen gegenüber gibt es, jedoch finden sie in unseren Nachrichtenkanälen nur wenig Beachtung. Auch über die Auswirkungen national bestimmter Handlungsweisen auf andere Gesundheitssysteme findet sich in der derzeitigen Berichterstattung nur sehr wenig – obwohl gerade das viel zitierte „Daheimbleiben“ oder die Vermeidung von Engpässen in der Produktion von Schutzkleidung Fragen der Solidarität wären.
Teilnehmer*innen gesucht: Aktuell sucht die Forschungsgruppe Zeitgenössische Solidaritätsstudien (CeSCoS) Freiwillige für die Teilnahme an einer Online-Interview-Studie über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Sie möchten erfahren, wie Bürger*innen in Europa auf die Pandemie reagieren und was sie über die Maßnahmen denken, die von ihren Regierungen vorgeschlagen oder auferlegt werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Mehr Informationen
Ein demokratiepolitisches Anliegen
Die Ergebnisse unserer Studie sollen über diese akute Krise hinaus einen Beitrag dazu leisten, neue Solidaritätspraktiken nicht nur zu verstehen, sondern sie auch langfristig und nachhaltig in anderen sozialpolitischen Fragen, beispielsweise der Impfpolitik, stärker zu verankern. Unsere Auseinandersetzung mit der aktuellen Renaissance des Solidaritätsbegriffs ist damit nicht nur ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt, sondern auch ein demokratiepolitisches Anliegen.

Katharina T. Paul, seit 2013 am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, leitet ein Elise-Richter-Projekt (FWF) zu Impfpolitik ("KNOW-VACC") sowie ein durch die EU (H2020) finanziertes Projekt zu Gesundheitsdiplomatie ("InsSciDE"). Seit 2017 ist sie Teil der Forschungsgruppe "Zeitgenössische Solidaritätsstudien" (CeSCoS). Zu ihren Forschungsinteressen gehören politische Steuerung im Gesundheitsbereich sowie die Rolle von Wissen und Evidenz in demokratischer Politikgestaltung. (© Sengmüller)

Katharina Kieslich kam 2018 an das Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und ist Teil der Forschungsgruppe "Zeitgenössische Solidaritätsstudien" (CeSCoS). Ihre aktuelle Forschung konzentriert sich auf vergleichende Gesundheitspolitik, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Patient*innen (PPI) an der Festlegung von Gesundheitsprioritäten, soziale Werte bei der Festlegung von Gesundheitsprioritäten und die Bewertung von Gesundheitstechnologien. (© derknopfdruecker.com)