"Corona ist ein schwarzer Schwan"
| 14. April 2020
Die österreichische Wirtschaft leider derzeit unter einem "Angebotsschock" – die Menschen möchten zwar konsumieren, können das aber nur sehr eingeschränkt. (© fotografierende/Pexels)
Die Corona-Krise ist global gesehen eine neue Erfahrung. Das macht ihre wirtschaftliche Einschätzung schwierig. Mit welchen Folgen werden wir auch nach der Krise kämpfen? Verhaltensökonom Martin Kocher gibt einen Ausblick.
Das Coronavirus wird die österreichische Volkswirtschaft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in eine Rezession stürzen. Je nach Dauer und Intensität der wirtschaftlichen Einschränkungen kann diese Rezession relativ mild ausfallen, mit rund minus zwei Prozent Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 oder sogar gravierender werden als alle Rezessionen seit dem Zweiten Weltkrieg.
Zum Vergleich: Während der Finanzkrise 2009 ist die heimische Wirtschaft um vier Prozent geschrumpft. Die Stärke der Rezession hängt davon ab, wie schnell die Ausbreitung der Krankheit eingedämmt werden kann und das Land wieder zurück zur wirtschaftlichen Normalität findet. Daneben hängen die wirtschaftlichen Folgen selbstverständlich auch davon ab, wie wirksam Gegenmaßnahmen wie Kredite, Haftungen, Umsatzersatz, Härtefonds, Stundungen und Kurzarbeit als Ausgleich sind.
Die Wirbelstürme der wirtschaftlichen Entwicklung
Gesamtwirtschaftliche Prognosen sind wie Wettervorhersagen. Bei stabiler Lage sind Konjunkturprognosen so einfach wie der Wetterbericht, selbst außergewöhnliche Phänomene wie Wirbelstürme kann man gut prognostisch beschreiben. Man kann ihre Entstehung nicht exakt vorhersagen, aber den Verlauf bestimmen. Die Wirbelstürme der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind wiederkehrende Rezessionen, die im Rahmen von Konjunkturzyklen auftauchen. Doch dann gibt es sogenannte "schwarze Schwäne". Der Begriff ist eine Analogie für Ereignisse, die man nicht vorhersehen kann. Sie haben zwar eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, ihre Folgen können aber massiv sein.
Die Corona-Krise ist so ein schwarzer Schwan, sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich. Zwar gab es Pandemien auch schon früher, aber meist waren es Krankheiten, deren Verlauf man einigermaßen stoppen oder verlangsamen konnte; zumindest jene neuen Pandemien, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Das Problem von COVID-19 ist die Rasanz, mit der sich die Krankheit ausbreitet, nachdem es nicht gelungen ist, sie in China einzudämmen.
Die erste Einschätzung des Instituts für Höhere Studien über die wirtschaftlichen Folgen von Corona ging vor knapp vier Wochen davon aus, dass die Verbreitung des Virus in China eingedämmt werden kann und es nur einzelne Fälle im Rest der Welt geben würde, ähnlich wie es bei der SARS-Epidemie 2003 der Fall war. Vor vier Wochen haben wir mit 0,1 bis 0,3 Prozentpunkten weniger Wachstum 2020 für Österreich gerechnet als erwartet, also mit gut einem Prozent Wachstumsrate der Wirtschaftsleistung. Innerhalb weniger Tage musste die Prognose nach unten angepasst werden. Als klar war, dass es massive Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens in Österreich durch das Schließen von Geschäften, Restaurants und Schulen geben musste, war auch klar, dass sich eine Rezession im Gesamtjahr 2020 nicht verhindern lassen wird.
Angebotsschock Corona-Krise
Ökonomisch wird die Corona-Krise als Angebotsschock bezeichnet. Es ist nicht so – wie zum Beispiel in der Folge der Finanzkrise –, dass die Menschen wirtschaftlich verunsichert wären und deshalb weniger konsumieren würden. Die Menschen würden gerne konsumieren, aber es gibt kein Angebot – daher Angebotsschock –, weil die Maßnahmen der Regierungen zu einer Einschränkung des wirtschaftlichen Lebens und zu Lieferengpässen in der internationalen Wirtschaft führen.
Ein solcher Angebotsschock, den es sonst nur bei Ressourcenknappheit oder bei Naturkatastrophen gibt, ist ein Szenario, auf das wir wirtschaftlich nicht gut vorbereitet sind. Wahrscheinlich kann man sich darauf aus wirtschaftlicher Sicht auch nur begrenzt vorbereiten. Mit Ausnahme des Ölpreisschocks, der sich aber bei weitem weniger rasant ausgebreitet hat, waren die Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte immer lokal begrenzt. Einen weltweiten Angebotsschock dieses Ausmaßes gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht.
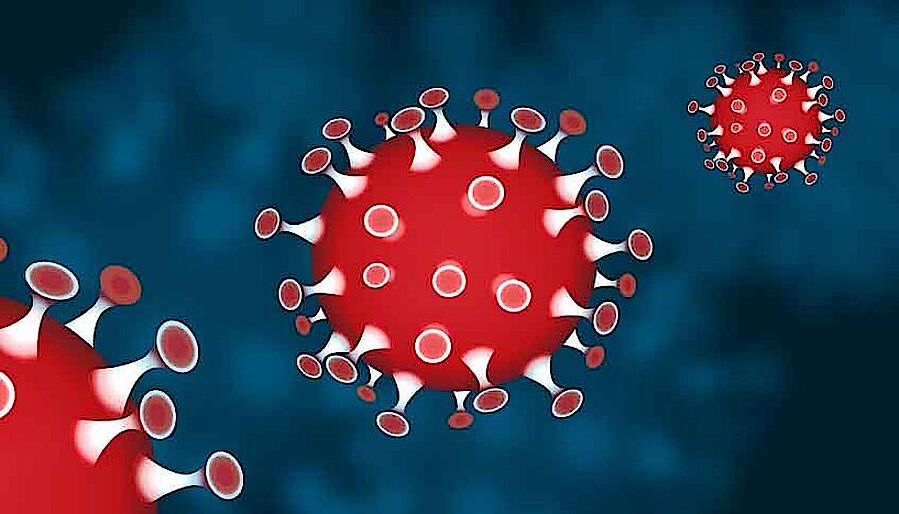
Coronavirus: Wie es unser Leben verändert
Von neuen familiären Abläufen bis hin zu Auswirkungen auf Logistikketten: Expert*innen der Universität Wien sprechen über die Konsequenzen des Coronavirus in den unterschiedlichsten Bereichen. (© iXimus/pixabay)
Zum Corona-Dossier
Die Krise in vier Phasen
Mittlerweile ist die gesamte Weltwirtschaft von der Corona-Krise erfasst. Man kann sie in vier Phasen einteilen: Unmittelbare Reaktion, wirtschaftspolitische Maßnahmen, mittelfristiges Aufholen und permanente Effekte.
1. Unmittelbare Reaktion
Die Bekämpfung des Coronavirus erfordert laut Mediziner*innen die Reduktion physischer Kontakte. Das führte zu einer massiven Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit in Österreich, die vor allem den Dienstleistungssektor betrifft. Das Schließen von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen reduziert die Produktivität, da berufstätige Eltern nun auf ihre Kinder aufpassen.
Die weltweite Ausbreitung des Virus trifft eine kleine Volkswirtschaft, für die Tourismus und Warenexporte wichtig sind, stärker als andere Länder. Zudem werden internationale Lieferketten unterbrochen und über Monate mit Unsicherheit behaftet sein, was für die Just-in-time-Produktion in der Industrie massive Probleme mit sich bringt. Die wirtschaftliche Aktivität geht daher V-förmig rasch nach unten. Das sieht man zum Beispiel an den stark steigenden Zahlen in der Arbeitslosenstatistik, den Anträgen für Kurzarbeitsbeihilfen und beim Stromverbrauch.
2. Wirtschaftspolitische Maßnahmen
Die österreichische Bundesregierung hat sich für jene wirtschaftspolitischen Maßnahmen entschieden, die auch viele andere Länder wählen oder wählen werden: Sie stellt Liquidität für Unternehmen bereit und ermöglicht Kurzarbeit. Die Idee dahinter ist, dass nach einer Aufhebung der notwendigen gesundheitspolitischen Maßnahmen die wirtschaftliche Aktivität wieder V-förmig nach oben gehen kann, weil gewisse wirtschaftliche Bereiche mit öffentlichen Mitteln quasi in einen Tiefschlaf versetzt werden. Zudem stellt die Europäische Zentralbank durch ein zusätzliches Wertpapierankaufprogramm weitere Liquidität für die Banken bereit, denen es gleichzeitig – durch ein Aufweichen der strengen Regeln – leichter gemacht wird, Kredite zu vergeben, um Liquiditätsengpässe bei Unternehmen und Privaten zu vermeiden.
3. Mittelfristiges Aufholen
Die Theorie, der Konjunkturverlauf könnte V-förmig aussehen, ist umstritten. Dabei geht es um den rechten Teil des V. Die entscheidende Frage dabei ist, ob die Analogie des Tiefschlafs von Teilen der Wirtschaft für einige Wochen oder sogar Monate realistisch ist. Wenn die wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht perfekt wirken, könnte auch der Aufholprozess länger dauern, weil Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, Unternehmen und Selbstständige vom Markt verschwunden sind oder andere wirtschaftliche Strukturen zerstört wurden.
Eine Phase der Unsicherheit auch nach Aufhebung der Einschränkungen könnte zu Konsumzurückhaltung führen und aus der Angebotskrise eine nachgelagerte Nachfragekrise machen. Die Erhöhung der öffentlichen Verschuldung könnte zu Problemen der Schuldentragfähigkeit führen. Aufgrund des in Österreich angekündigten 38-Milliarden-Pakets zur Bekämpfung der Krise und des Ausfalls von geplanten Steuereinnahmen wird der Bundesrechnungsabschluss 2020 naturgemäß tiefrote Zahlen aufweisen. Das Institut für Höhere Studien rechnet derzeit mit einem Budgetdefizit von rund fünf Prozent der Wirtschaftsleistung, was in etwa der Höhe des Defizits im Jahr 2009 entspricht. Ein solches Defizit würde die Schuldentragfähigkeit Österreichs nicht gefährden, obwohl es den Schuldenstand der Republik wieder in Richtung 80 Prozent der Wirtschaftsleistung bringen würde.
Der große Vorteil gegenüber 2009 ist, dass die Zinsen auf Staatsschulden derzeit sehr gering sind und damit die zukünftigen Budgets weniger belasten. Aber Länder wie Italien oder Griechenland werden finanzielle Hilfe benötigen, um nicht (wieder) in die Nähe eines Ausfalls zu kommen. Zudem könnte es Flurschäden im wirtschaftlichen Gefüge geben, die wir jetzt noch nicht vollständig erkennen. Auch nach der Finanzkrise hat es Jahre gedauert, bis der wirtschaftliche Status quo wieder erreicht war, und das langfristige Problem der europäischen Staatschuldenkrise als induzierter Effekt war letztlich schwieriger zu lösen als die Verwerfungen nach der Lehmann-Pleite.
4. Permanente Effekte
Einige Erfahrungen aus der aktuellen Krise werden permanente Effekte haben. Der Grad der Digitalisierung am Arbeitsplatz wird einen weiteren Sprung machen. Die Globalisierung wird weiter eingebremst; ihre Dynamik war in den letzten Jahren schon stark abgeschwächt worden. Internationale Organisationen werden sich stärker Gedanken machen müssen, inwieweit man Epidemien lokal eindämmen kann, und man wird dafür verstärkt Mittel brauchen – zur Beobachtung, aber auch zur schnellen Bekämpfung im Falle eines Ausbruchs. Bei den Zulieferketten wäre es sinnvoll stärker auf Diversifikation setzen, um im Fall von Lieferausfällen einzelner Ländern besser gerüstet zu sein. Die Rückholung der Produktion von Asien nach Europa löst das Problem nicht, denn auch in Europa kommt es aufgrund der Corona-Krise zu Produktionsengpässen und Lieferschwierigkeiten zum Beispiel durch Grenzschließungen.
Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kann im Moment niemand seriös in Zahlen abschätzen. Wir können nur in Szenarien rechnen. Letztlich sind die gesamtwirtschaftlichen Kosten eine Funktion der Dauer der wirtschaftlichen Einschränkungen. Je länger sie dauern, desto höher werden die Kosten. Der Anstieg der Kosten ist dabei über-linear, weil mit zunehmender Länge der Maßnahmen immer mehr mittelfristige und langfristige wirtschaftliche Kosten anfallen. Daher scheint eine möglichst massive Bekämpfung der Krankheit mit starken Maßnahmen optimal, weil sie im Idealfall die mittel- und langfristigen Kosten senkt.
Der Originalbeitrag "Die Corona-Rezession" von Martin Kocher ist in Addendum erschienen.

Martin Kocher ist Professor für Verhaltensökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre und am Wiener Zentrum für Experimentelle Wirtschaftsforschung der Universität Wien und Direktor des Instituts für Höhere Studien (© Barbara Mair).



