Der Kampf mit einem unsichtbaren Gegner
| 23. März 2020
In Zeiten von Epidemien kamen Pestdoktoren v.a. in Städten mit hohen Opferzahlen zum Einsatz, im 17., 18. und 19. Jahrhundert trugen einige von ihnen Schnabelmasken, die mit Kräutern und Flüssigkeiten gefüllt waren. Kolorierter Kupferstich eines Pestdoktors von Paul Fürst, Der Doctor Schnabel von Rom, ca. 1656 (© wikimedia/public domain)
Was haben die Versinschriften des römischen Kaiserreiches mit dem Coronavirus zu tun? In seinem Gastbeitrag erklärt der Kulturhistoriker und Epigraphiker Peter Kruschwitz, wieso antike Epigramme einen Beitrag zum Verständnis der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf uns alle leisten können.
Epidemien und Pandemien sind keine neue Erfahrungen für die Menschheit. So hat beispielsweise der antike Historiker Thucydides der berühmten Pest in Athen ein bis heute berühmtes Denkmal gesetzt, und der römische Dichter Lukrez hat das damit verbundene menschliche Leid sodann in unvergänglichen, schaurig-schönen Versen verewigt. Die Auswirkungen einer kaiserzeitlichen Pandemie im 2. Jahrhundert, der sogenannten Antoninischen Pest, waren sogar bis ins römische Österreich zu spüren.
Ohne Frage, jede Epidemie, jede Pandemie stellt die Medizin ebenso wie die Politik vor gewaltige neuartige Herausforderungen. Aber, und dies zeigt sich im gegenwärtigen Fall ebenso wie aus historischer Perspektive, nicht nur Medizin und Politik geraten an ihre Grenzen. Die Extremsituation betrifft uns alle, individuell und als Gemeinschaft, mit noch nicht abschätzbaren Folgen: Massenerkrankungen haben ein großes Spektrum an menschlichen Dimensionen.
Welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um in Zeiten akuter pandemische Erkrankungen – zumal bei bislang fehlenden medizinischen Lösungen (von der Behandlung der Symptome einmal abgesehen) – unbeschadet zu überleben, können wir bereits aus zwei römerzeitlichen Epigrammen aus Kleinasien lernen: Distanz halten – und strikte Körperhygiene.
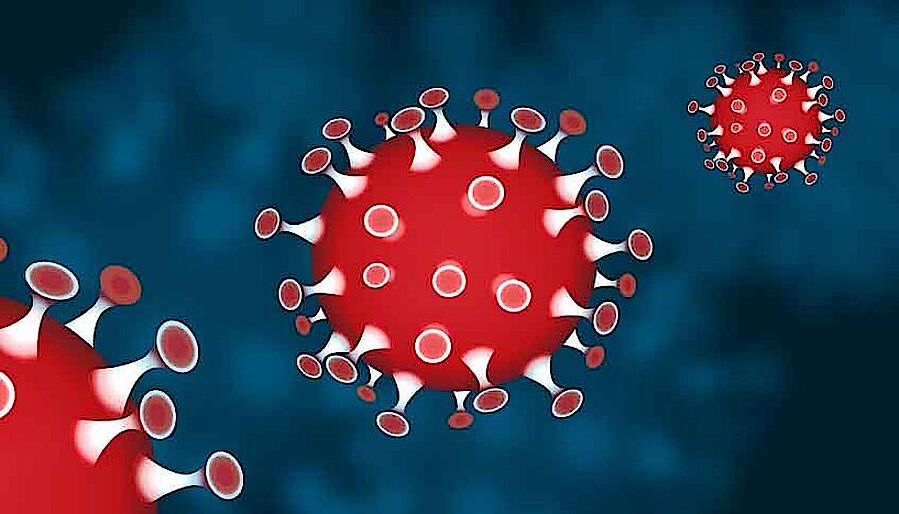
Coronavirus: Wie es unser Leben verändert
Von neuen familiären Abläufen bis hin zu den Auswirkungen auf Logistikketten: Expert*innen der Universität Wien sprechen über die Konsequenzen des Coronavirus in den unterschiedlichsten Bereichen.
Zum Corona-Dossier
Antike Dichtung als Schlüssel zum Verständnis
Die in den Steinepigrammen der römischen Zeit festgehaltenen Reaktionen auf Epidemien berichten von Tod, Leid und Schmerz ebenso wie vom verzweifelten Kampf gegen das massenhafte Sterben und die nachhaltige Veränderung menschlichen Lebens zu Krisenzeiten.
Die Analyse des antiken Quellenschatzes befördert nicht nur unser historisches Verständnis von Pandemien. Indem wir nachvollziehen, wie die breiten, ethnisch und kulturell ganz diverse Bevölkerungsschichten über Pandemien denken und sich diese vorstellen, können wir heute ganz konkret helfen, den Umgang mit tiefsitzenden Sorgen und Urängsten und den daraus resultierenden Verhaltensweisen zu verstehen und zu gestalten. Kulturhistorische und mentalitätsgeschichtliche Forschung auf diesem Gebiet ist also nicht (nur) Selbstzweck, sondern dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Der unsichtbare Gegner
Dass ein vages Wissen um eine rasch herannnahende, potentiell tödliche Bedrohung tiefe Ängste auslöst, ist nicht überraschend, und das umso mehr, da man das Virus ja nicht kommen sieht, hört oder riecht. Wie kann man sich gegen einen unsichtbaren Gegner wappnen? Motivgeschichtlich ist es kaum überraschend, dass da Atemschutzmasken, obschon zum Selbstschutz objektiv wenig wirksam, rasch zu Visieren hilflos zusammengeflickter Rüstungen gegen den unsichtbaren Gegner umfunktioniert werden.
Aber wo genau lauert die Gefahr? Wir alle haben unsere kollektiven Vermutungen. Sofern wir nicht dummdreist das Risiko suchen, sind wir auf der Hut. Die Scheu und die Skepsis, mit der wir einander zur Zeit in der Öffentlichkeit begegnen, sprechen Bände.
Römerzeitliche Epigramme aus Vorderasien greifen für diese Form der Bedrohung mehrfach auf ein eindrückliches Sprachbild zurück. Sie sprechen von einer 'Pestwolke' – einem Gefahrennebel, dem mit menschlichen Mitteln nicht beizukommen ist. Poetische Orakel und Gebete aus derselben Region sagen, dass die Gefahr selbst mit göttlichem Beistand nicht vollends aufzulösen sei. Allenfalls in eine andere Richtung gelenkt werden könne der todbringende Dunst (und dann bevorzugt natürlich zu irgendeinem Nachbarvolk, mit dem man sich ohnehin noch nie gut verstand).
Sind die derzeit zu beobachtenden nationalen Alleingänge bei der Bewältigung der Krise dieser antiken Denkweise wirklich wesensfremd? Gibt es eigentlich noch effektiv arbeitende transnationale Bündnisse und Organisationen im Moment? Von ihnen ist angesichts des globalen Ausmaßes der Krise in Zeiten des Isolationismus erstaunlich wenig zu hören.
Und wie lange werden wir warten müssen, bis uns endlich jemand in klarer Sprache vermittelt, dass nicht die Atemluft, nicht unsere Mitbürger*innen, sondern wir selbst die Gefahr darstellen, dass also der Schlüssel zur Lösung des Problems in unserem eigenen Verhalten liegt?
Ohnmachtsgefühl und abruptes Ende der Lebensplanung
Viele Epidemien betreffende Epigramme aus dem römischen Reich eint das verzweifelte Ringen darum, dem eigenen Ohnmachtsgefühl beizukommen. Bei wem kann man sich beschweren, wenn einem frühzeitig schuldlose Angehörige – oftmals in der Mehrzahl – genommen wurden? Es ist da von dunklen Tagen die Rede, von unentrinnbaren, nachgerade dämonischen Krankheiten, die mit der einen Hand alles Wachsende dahinraffen und mit der anderen Hand die schlimm entstellten Opfer als Trophäe emporhält. Die durch Fieber erlittenen Qualen und Schmerzensschreie selbst kleinster Kinder werden in diesen Texten wieder lebendig und erlebbar.
Auch wir erfahren die Ohnmacht – eine Ohnmacht, die in Selbstisolation nicht nur zur Produktion von Internet-Memes, sondern zu sehr realen psychischen Problemen führt. Wer wird sich unserer Probleme annehmen? Und wie? Die Lage in den Krisengebieten wird zunehmend bedrückender.
Und wer hilft den Helfenden?
Die Coronavirus-Krise ist eine kollektive psychologische Extremsituation. Sie macht uns Angst, unabhängig von sozialem Hintergrund oder Bildungsstand. Wir sorgen uns natürlich um unsere Gesundheit und ökonomische Absicherung sowie auch die derjenigen, die uns nahestehen. Uns hält eine diffuse, nebulöse Angst vor einer ungewissen, unerfreulichen Zukunft im Griff, die unsere bisherigen Lebensentwürfe durchkreuzt und unsere Freiheiten einschränkt.
Wie in jeder Extremsituation gibt es Heldinnen und Helden
Der Name Li Wenlian hat vor kurzem traurige Bekanntheit erlangt: Es ist der Name des chinesischen Arztes, der die Welt vor dem Coronavirus warnte und dann selbst an den Folgen der Seuche verstarb. Überall auf der Welt wird derzeit denjenigen öffentlich applaudiert, die sich der Gefahr entgegenstellen und uns allen zu überleben helfen.
Dieses Gefühl der Dankbarkeit verbindet uns mit den Einwohnern von Nea Klaudiupolis, heute in der Nordtürkei gelegen. Dort verstarb im 2. oder 3. Jahrhundert eine Ärztin namens Domnina, der ein ehrendes Andenken bewahrt wurde:
Hinaufgeeilt bist du, Domnina, zu den Unsterblichen, den Ehemann vernachlässigend, und hast deinen Leib bei den himmlischen Sternen gereinigt; keiner der Menschen wird sagen, dass du gestorben seiest, sondern dass die Unsterblichen dich weggerafft haben, als du die Vaterstadt vor den Krankheiten retten wolltest. Sei gegrüßt und genieße das Elysium; aber deinen Gefährten hast du hinterlassen Trauer und ewige Klagen.*
Wir schulden allen, die ihr eigenes Wohl dem Allgemeinwohl bis zur Aufopferung unterordnen, unseren aufrichtigen, uneingeschränkten Dank.
Und wir sollten ihr Vorbild zum Anlass nehmen, mit unseren eigenen Ängsten umzugehen. Die große Herausforderung dabei wird es sein, den nicht-medizinischen Dimensionen der Pandemieerfahrung mit der gebührenden Ernsthaftigkeit zu begegnen, anstatt sie zu ignorieren: Sie sind Ausdruck tiefsitzender, realer Ängste und Sorgen, und wir müssen lernen, die ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen von pandemischen Erkrankungen zu verstehen. Nur so können wir in der Krise umfassend Hilfe leisten – und auch denjenigen helfen, die derzeit täglich unter Preisgabe ihrer eigenen Gesundheit ihr möglichstes tun, unser aller Überleben zu sichern.

Peter Kruschwitz ist Professor für Antike Kulturgeschichte im Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik an der Historisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und Principal Investigator des ERC-Advanced-Grant-Projekts MAPPOLA – Mapping out the poetic landscape(s) of the Roman Empire (2019–24). Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Römische Kulturgeschichte mit Schwerpunkt auf den musisch-poetischen Ausdrucksformen und Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte.
Der Artikel "Eine kleine Poetik der Seuche. Epidemien im Spiegel römischer Versinschriften" von Peter Kruschwitz erscheint in der Zeitschrift "Gymnasium: Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung".
*Übersetzung: Merkelbach – Stauber



