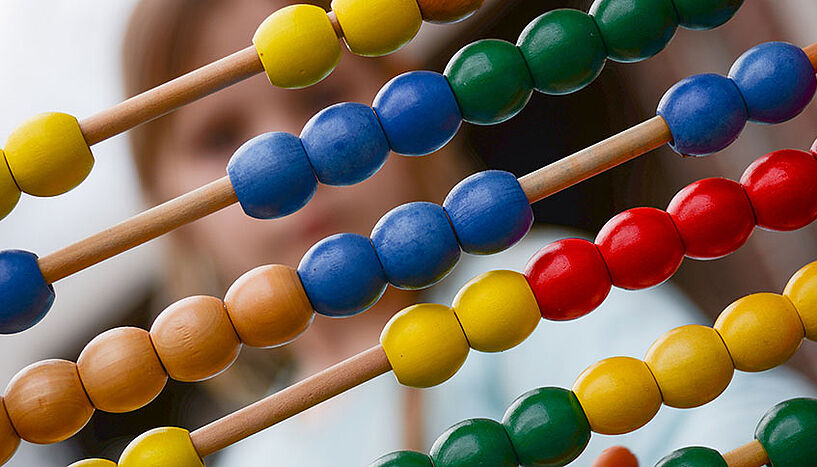Beschult, integriert und selektioniert
| 08. Januar 2019Was eint und trennt die Bildungssysteme in Europa? Wem überlassen wir eigentlich Bildung und Schule? Über diese Fragen diskutieren im Semesterfrage-Interview die Bildungsexperten Manfred Prenzel und Daniel Tröhler.
uni:view: Herr Prenzel, Herr Tröhler, Sie beide sind Experten in den Bereichen Bildung, Pädagogik und Schulsystem. Wie beantworten Sie aus Ihrer fachlichen Perspektive heraus unsere Semesterfrage "Was eint Europa?".
Manfred Prenzel: Wir haben viele kulturelle Bezüge. Uns eint eine gemeinsame Geschichte, die wir zum Teil sehr unfreundlich und auch kriegerisch bewältigt haben. In den letzten Jahrzehnten haben wir einen Weg gefunden, eng zusammenzuarbeiten. In dem Rahmen spielt natürlich auch die Bildung eine große Rolle bei der Verständigung.
Daniel Tröhler: Mich reizt, die Frage umzukehren: Was trennt uns? Das Schulsystem – nicht die höhere Bildung – ist nach wie vor maßgeblich dazu da, nationale Integration zu gewährleisten und Identität innerhalb territorialer Grenzen zu schaffen und dabei ein nationales "Uns" zu schaffen, das von "Anderen", den "Fremden", getrennt ist.
Prenzel: Ich teile die Auffassung, dass das Bildungssystem stark zum nationalen Verständnis beigetragen hat. Aber wir finden heute nicht nur in Europa, sondern auch weltweit curriculare Elemente, die weitestgehend ident sind. Mathematik zum Beispiel ist in Südamerika nicht viel anders als in Europa. Innerhalb Europas haben wir überhaupt eine ziemlich ähnliche Vorstellung eines Curriculums. Auch wenn einige natürlich stark national geprägt sind, etwa der Geschichtsunterricht.
Tröhler: Geografie, Geschichte, Sprache, Literatur etc. Man liest in Deutschland Goethe oder Schiller, in Frankreich Racine oder Molière, in der Schweiz Dürrenmatt oder Frisch. Das ist einfach so. Selbst bei der Mathematik gibt es Unterschiede. Es gibt das schweizerische Rechenbuch und es gibt das deutsche Rechenbuch.
Prenzel: Wir haben in vielen Projekten von der Schweiz profitiert, weil sie eine andere Mathematik gemacht haben.
Tröhler: Ja eben, das meine ich.
Prenzel: Es gibt Unterschiede, aber das gleiche Ziel: Mathematik als Werkzeug, um Probleme lösen.
Jedes Semester stellt die Uni Wien ihren WissenschafterInnen eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft aktuell bewegt. Die Semesterfrage im Wintersemester 2018/19 lautet "Was eint Europa?". Zum Thema Bildung in Europa hat uni:view mit Bildungswissenschafter Daniel Tröhler (li.) sowie Manfred Prenzel (re.), dem Leiter Zentrums für LehrerInnenbildung, gesprochen. (Fotos: © Uni Wien/Barbara Mair)
uni:view: Gerade, wenn wir etwas genauer hinsehen, gibt es doch Unterschiede innerhalb der europäischen Schulsysteme. Wie sehen diese konkret aus?
Prenzel: Eine Frage lautet hier: Wann differenziert ein Schulsystem? Alle Schulsysteme in Europa tun dies zu einem bestimmten Zeitpunkt, manche bereits mit zehn Jahren, andere mit 14 und wieder andere erst mit 18 Jahren. Jene, die früh differenzieren, tun dies im Glauben stärkerer individueller Förderung. Jene, die später differenzieren, sagen, dass es für die soziale Kohäsion und die gemeinsame Entwicklung wichtig ist.
Tröhler: Wir haben uns im Westen bzw. fast global dazu bekannt, dass von ca. sechs bis 16 Jahren beschult, (national) integriert und (sozial) selektioniert werden muss. Aber in der internen Organisation – gerade was Hierarchien betrifft – gestaltet es sich dann doch sehr unterschiedlich. Wann kommt die Selektion zwischen Primär- und Sekundärstufe? Tendenziell lässt sich sagen, dass die katholischen Länder früher selektieren, die protestantischen Länder später. Das sind kulturelle Tendenzen in der Frage, ob Staaten eher eine hierarchische oder eine egalitäre Gesellschaft haben möchten.

Am 14. Jänner 2019 findet die Abschlussveranstaltung zur aktuellen Semesterfrage im Audimax statt. Nach einem Impulsreferat von Franz Vranitzky, österreichischer Bundeskanzler 1986-1997, zum Thema "Was eint Europa?" diskutieren mit ihm am Podium Sylvia Hartleif, Leiterin Außenpolitik (Europäisches Zentrum für politische Strategie/Europäische Kommission), die österreichische Schriftstellerin Maja Haderlap, EU-Aktivistin und Studentin Nini Tsiklauri sowie seitens der Universität Wien Gerda Falkner vom Institut für Europäische Integrationsforschung und Martin Kocher vom Institut für Volkswirtschaftslehre und IHS-Leiter. Moderiert wird der Abend von "DerStandard"-Chefredakteur Martin Kotynek.
uni:view: Was ist Ihre Meinung zur vielzitierten PISA-Studie?
Tröhler: Eine schwierige Diskussion. Wollen wir das kurzhalten? (lacht)
Prenzel: Ich bin insofern parteiisch, da ich in Deutschland das Programm geleitet und auch Testkonzeptionen mitentwickelt habe. Das hätte ich ohne gute Gründe nie getan. Trotzdem würde ich PISA keineswegs idealisieren. Für mich stellt sich die Frage: Was ist die Funktion solcher Monitoring-Instrumente und wo sind ihre Grenzen? Für Deutschland kann ich sagen, dass wir gerade durch PISA auf Probleme im Bildungssystem aufmerksam wurden, die vorher immer verdrängt wurden. Stichwort: Bildungsgerechtigkeit.
Tröhler: Ich bin bezüglich PISA sehr viel skeptischer als Herr Prenzel und bereits gegenüber dem Monitoring skeptisch. Es beinhaltet normative Thesen darüber, was als wichtig und unwichtig erachtet wird. Diese normativen Thesen wurden jedoch nie diskutiert, sondern vorausgesetzt. Zum Beispiel, warum Physik, Mathematik und Sprachen so einen großen Stellenwert haben. Ursprünglich wurde dieses Monitoring in den USA in den 1960er Jahren in der Folge von Sputnik und der Humankapitaltheorie entwickelt, um den Output des hochgradig föderativen Schulsystems zu messen. Was ist also die Wertigkeit der PISA-Studie? Statistiken bilden nicht nur Wirklichkeiten ab, sie erzeugen sie auch.
Prenzel: Es gibt für alle Testbereiche normative Bezugspunkte, auch für Schule und Unterricht. Aber ich teile die Auffassung, dass es Domänen gibt, die zu sehr im Hintergrund stehen. Grundsätzlich sollte die Frage ja lauten: Was müsste jemand in der Mathematik mit 14 oder 15 Jahren verstanden haben? Interessant im Rahmen der PISA-Studie fand ich die Diskussionen über unterschiedliche Vorstellungen von Mathematik.
Tröhler: Ja, eben. Und die Frage ist, wer das Recht hat, zu entscheiden, was die richtige Vorstellung ist, mit der dann Leistungen kulturvergleichend gemessen werden.
Prenzel: Und es gab einige Ergebnisse der PISA-Studie, die überrascht haben. So wusste man etwa – zumindest in Deutschland – nicht, wie viele SchülerInnen eigentlich Klassen wiederholen. Da gab es drastische Unterschiede zwischen den Bundesländern. Über Strukturen, Bildungsprozesse und -ergebnisse sollten wir mehr wissen. Hier hat sich in Europa schon einiges getan, die Politik sieht sich inzwischen verpflichtet zu handeln.
Tröhler: Die Frage ist, wem überlassen wir eigentlich die Bildung und die Schule. Derzeit haben wir zwei Modelle: Entweder wir überlassen sie mehr oder weniger der Bevölkerung wie in den USA mit den School Boards und der Schweiz mit ihren Schulpflegen oder "ExpertInnen", wer immer diese als ExpertInnen benennt. PISA nimmt oftmals eine sehr starke expertokratische Position ein, à la man wisse, wie es sein sollte, während PolitikerInnen und Laien zu einfältig dafür seien. Das ist keine gute Entwicklung. Auf der anderen Seite hat die extreme Demokratie ein großes Problem, wenn Laien alles entscheiden können. Dann kann es tatsächlich – so wie in Kansas – passieren, dass die Biologie aus dem Lehrplan gestrichen und die Schöpfungslehre als die Wahrheit über das Wesen des Menschen eingeführt wird. Ich denke, die Antwort muss irgendwo dazwischenliegen. Man braucht ExpertInnen, aber Bildung gehört zunächst immer noch dem Volk.
Prenzel: Ja, so lange es nicht um staatliche Institutionen und Professionalität geht. Da sollten schon ExpertInnen mitreden. Es wäre z.B. nicht auszuschließen, dass Eltern in bestimmten Ländern die Prügelstrafe wiedereinführen würden. In vielen Bereichen haben wir inzwischen einen Konsens und auch gute Gründe dafür, dass es so ist, wie es ist. Das sollte man nicht in die Hände von irgendwelchen Volksabstimmungen geben.
Tröhler: Die Art der zusehends global zentrierten Expertokratie muss meiner Meinung nach Grenzen haben. Ich habe nichts gegen sie, solange sie innerhalb ihrer Grenzen operiert und nicht als allwissend auftritt und politisch als solches wahrgenommen wird. Demokratie funktioniert per definitionem als Herrschaft der Nicht-ExpertInnen, also des Volkes, und das sollte für die Volksschule eine gute Basis sein.
uni:view: Vielen Dank für das Gespräch! (td)
Manfred Prenzel ist seit April 2018 Professor für Empirische Bildungsforschung am Institut für LehrerInnenbildung, zudem leitet er das Zentrum für LehrerInnenbildung. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. Lernprozesse, Bildungsmonitoring, Internationale Schulleistungsvergleiche, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung.
Daniel Tröhler ist seit Jänner 2017 Professor für Allgemeine Pädagogik am Institut für Bildungswissenschaft. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. Entwicklung der Schulsysteme in internationaler Perspektive, Geschichte und Geschichtsschreibung der Erziehung und Bildung, Pädagogisierung sozialer Probleme sowie Bildungspolitik.