Katastrophenschutz in Österreich – Teil 2
Redaktion (uni:view) | 02. Juni 2017Vom 21. bis zum 28. Mai sind die TeilnehmerInnen des Universitätslehrgangs "Risikoprävention und Katastrophenmanagement" in Österreich unterwegs. Die Exkursion unter der Leitung von Thomas Glade vom Institut für Geographie- und Regionalforschung führt die Studierenden von Wien bis nach Vorarlberg.

Am dritten Tag der Exkursion besuchen wir das Flugrettungszentrum West des ÖAMTC in Innsbruck, eines von zwei Flugrettungszentren in Österreich. Bei diesem Exkursionsziel liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass wir einen Einblick in die Organisation der Flugrettung bekommen und das operative Geschäft der ÖAMTC Flugrettung kennenlernen. Auf dem Bild ist der Einsatzhubschrauber des ÖAMTC, der Eurocopter 135, zu sehen, der für Rettungs-, aber auch bei Unterstützungseinsätzen verwendet wird (Foto: Ricardo Stauder, Text: Ricardo Stauder, Angelika Spiegel)

Um Sicherheit bei Einsätzen der Flugrettung zu steigern, wird die Technik in den Hubschraubern stetig erweitert und erneuert. Zukünftig werden die Hubschrauber mit Autopiloten ausgestattet, welche die Piloten sogar bei einem Schwebeflug unterstützen können. (Foto: Ricardo Stauder, Text: Ricardo Stauder, Angelika Spiegel)

Durch das Flugrettungszentrum führen uns Flight Safety Manager und Einsatzpilot Captain Klaus Egger und Martin Weger, technischer Leiter HELIAIR. In den beiden Flugrettungszentren mit Werften (West und Ost) müssen alle ÖAMTC Hubschrauber jährlich gewartet werden. Von den insgesamt 32 Hubschraubern sind zwei immer in Wartung, die ca. zwei Wochen dauert. Zusätzlich werden Wartungstätigkeiten und Reparaturen an ungarischen, tschechischen, deutschen, finnischen und teilweise an Hubschraubern des BMI durchgeführt. (Foto: Ricardo Stauder, Text: Ricardo Stauder, Angelika Spiegel)

Das Programm des vierten Exkursionstages führt die Gruppe nach der Flugrettungszentrale in Innsbruck an den Anfang des Paznauntales. Unmittelbar an der Gemeindegrenze zwischen See und Kappl fließt der Schallerbach mit einem Einzugsgebiet von 8,3 km² aus einer Ursprungshöhe von rund 3000 Metern zu seiner Mündung in Trisanna auf einer Seehöhe von etwa 1000 Metern. Das waldbestandene Gelände ist geprägt von mit Lockermaterial bedeckten Gneisen. (Foto: Michael Sartori, Text: Fabio Stauder und Michael Sartori)

Das neue Rückhaltebecken mit der als massive Stahlbetonmauer (8.000m³ Beton verarbeitet) ausgebildeten Sperre führt mittig zu einem rechenartig angelegten Ausfluss mit vertikalen Durchlässen. Dadurch sollen Wasser, kleine Sedimente und Geschiebeteile geringeren Umfangs abfließen können, während die großen Anteile im Becken zurückgehalten werden. Die "Rechenzinken" im Abflussbereich sind stahlarmiert, um vom Gescheibe, welches der Abfluss mitführt, nicht "abgenützt" bzw. zerstört zu werden. Treibholz kann schwimmend bei ungehindertem Wasserabfluss entlang des Rechens aufsteigen und bleibt dann an den obigen Hacken hängen, ohne den Überlauf des Bauwerks zu verklausen. (Foto: Michael Sartori, Text: Fabio Stauder und Michael Sartori)

Der Schallerbach fällt über eine Höhe von ca. 40 Metern in zwei Kaskaden steil in das Rückhaltebecken ab. Das Bild wurde auf etwa zwei Drittel der Höhe von einem Kaskadenabsatz aufgenommen. Deutlich sichtbar ist das Murrückhaltebecken und dahinter die zu schützenden Siedlungen und das verstärkte Abflussgerinne. (Foto: Michael Sartori, Text: Fabio Stauder und Michael Sartori)

Der fünfte Tag startet bei sonnigem Wetter im Ort Galtür, der stillen und zurückhaltenderen Schwester von Ischgl im hinteren Paznauntal auf einer Seehöhe von etwa 1.500 Meter. Unser Weg führt uns in das weltberühmte Alpinarium, wo uns Bürgermeister und Landtagsvizepräsident Toni Mattle empfängt. Das Alpinarium ist zentraler Bestandteil einer 345 Meter langen und 6 Meter hohen Lawinenschutzmauer, welche nach dem Lawinenunglück vom 23. Februar 1999 errichtet wurde. Dieses Museum stellt eine moderne Erinnerungsstätte, eine Informations- und Dokumentationsplattform und gleichzeitig einen alpinen Schutzbau dar. Mit verschiedenen Dauerausstellungen wird das Verhältnis zwischen Mensch und Natur im hochalpinen Raum eindrucksvoll vermittelt. (Foto: Philipp Wiatschka, Text: Wolfgang Blaschke, Klaus Kothgasser und Wolfgang Uhrmann)
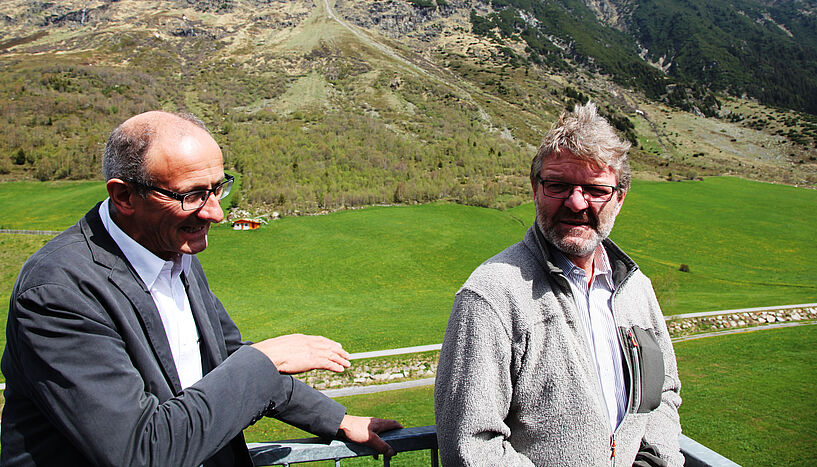
Bürgermeister Anton Mattle führt uns persönlich durch das Museum und erläutert die Ortsgeschichte von Galtür. Der Bürgermeister schildert uns das gesamte Ausmaß des Lawinenunglücks 1999 und erklärt das Konzept der heutigen Schutzmaßnahmen. Mit seinen persönlichen Aufzeichnungen erzählt uns Toni Mattle in eindringlicher Art und Weise Erlebnisse und Eindrücke, welche damals auf den Ortschef wirkten. Nach dem Vortrag herrscht beeindruckende Stille und Anteilnahme unter den StudentInnen. (Foto: Wolfgang Blaschke, Text: Wolfgang Blaschke, Klaus Kothgasser und Wolfgang Uhrmann)

Die Landschaft ist geprägt von imposanten Schutzeinrichtungen wie dieser Steinmauer, welche zur Abwehr gravitativer Massenbewegungen errichtet wurde. Hierbei soll vor allem der gefährliche Fließanteil von Lawinen gestoppt werden. Durch intensive Geländeanalysen und eine konsequente Umsetzung des Gefahrenzonenplans soll eine naturgefahrenbewusste Raumordnung erzielt werden. (Foto: Philipp Wiatschka, Text: Wolfgang Blaschke, Klaus Kothgasser und Wolfgang Uhrmann)

Dieses Haus ist ein Beispiel für präventive Selbstschutzmaßnahmen der 1930er Jahre. Die Bauwerke wurden hinter natürlichen Barrieren wie Felsen, Gräben und Wälder zum Schutz vor Steinschlag, Muren oder Lawinen errichtet. (Foto: Wolfgang Blaschke, Text: Wolfgang Blaschke, Klaus Kothgasser und Wolfgang Uhrmann)

Am Nachmittag marschieren wir zu den Lawinenverbauungen auf eine Seehöhe von 2100 Metern. Bürgermeister Toni Mattle vermittelt einen Überblick über das Tal und die verborgenen Gefahren des hochalpinen Geländes. Ein Leitsatz des Bürgermeisters: "So schön wie die Berge sind – so grausam können sie auch sein." (Foto: Philipp Wiatschka, Text: Wolfgang Blaschke, Klaus Kothgasser und Wolfgang Uhrmann)

Lawinenverbauungen u.a. am Grieskogel sollen die Mobilisierung von Schneelawinen verhindern. Die vier Meter hohen Stahlbauten werden hubschraubergestützt installiert. Defekte Schutzbauten stellen ein enormes Risiko für Kaskadeneffekte dar. Deshalb werden diese jährlich durch Sachverständige geprüft. (Foto: Philipp Wiatschka, Text: Wolfgang Blaschke, Klaus Kothgasser und Wolfgang Uhrmann)

Am letzten Tag der Exkursion besuchen wir das Bezirkspolizeikommando (BPK) Bregenz, wo Michael Rössler der BPK Bregenz, Philip Stadler, Gerhard Lauterer und Klaus Ländle (alle von der Österreichische Wasserrettung Vorarlberg – kurz ÖWR) im Zuge eines kurzen theoretischen Vortrags sowohl die ÖWR als auch der Seedienst der Bundespolizei vorgestellt wurden. Das Boot der Österreichischen Wasserrettung Vorarlberg, die als ehrenamtlicher Verein geführt wird, ist das größte des Vereins. Die Aufgaben der Österreichischen Wasserrettung in Vorarlberg sind Tauchen, Wildwasser und Nautik sowie Überwachungsdienst, welcher auch die Bäder- und Veranstaltungsüberwachungen miteinschließt. (Foto: Paar)

Auch der Seedienst der Polizei verfügt über Boote am Bodensee und ist fixer Bestandteil der Rettungskette. Auf dem größten Schiff in der Flotte der Polizei (dem Boot V20 der PI Hard LPD Vorarlberg) werden Einsätze im österreichischen Gebiet geführt. Neben sicherheitspolizeilichen Aufgaben wird vor allem Wert auf Kriminalprävention am See gelegt. (Foto: Paar)



