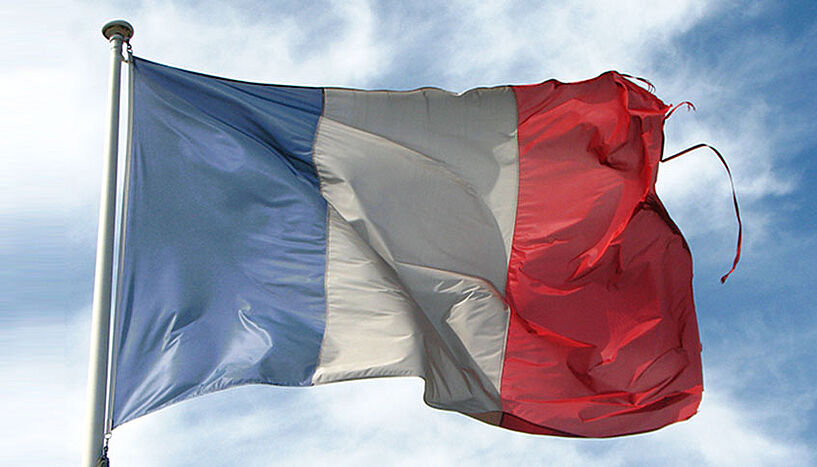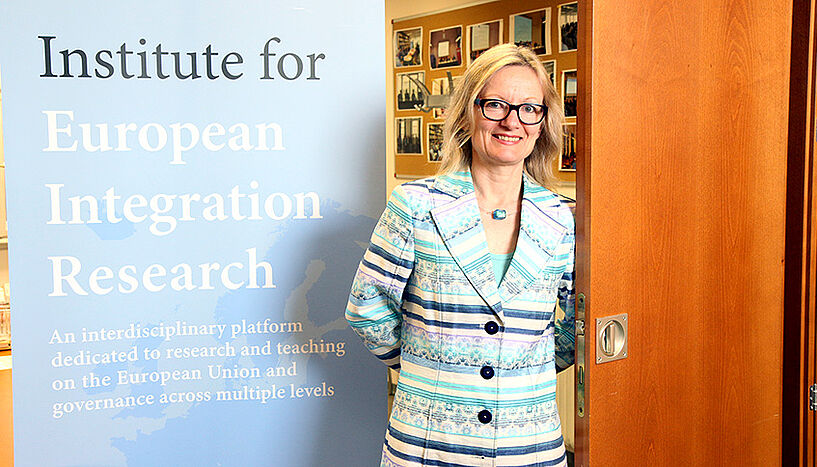John F. Kennedy: Vorbild für eine ganze Generation
| 29. Mai 2017
John Fitzgerald "Jack" Kennedy, von vielen einfach "JFK" genannt, war von 1961 bis 1963 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. (Foto: White House Press Office photograph/CC0)
Jung, strahlend und beliebt – John F. Kennedy, der 35. Präsident der USA, wäre heute, am 29. Mai 2017, hundert Jahre alt geworden. uni:view sprach mit dem Politikwissenschafter Heinz Gärtner über den "Mythos JFK", die Kubakrise und die Unterschiede zu Donald Trump.
uni:view: Kaum ein anderer US-Präsident wird auch heute noch – immerhin über 50 Jahre nach dessen Tod – derart verehrt wie John F. Kennedy. Wie ist der Mythos rund um seine Person zu erklären?
Heinz Gärtner: Der Mythos John F. Kennedy basiert auf mehreren Aspekten. Zunächst einmal muss man wissen, dass Kennedy schon aufgrund seiner Jugend und seines Charismas für viele Menschen – nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt – als wichtiger politischer Hoffnungsträger galt. Seine Wahl zum US-Präsidenten fiel in eine Zeit, die von einem generellen wirtschaftlichen Aufschwung und einer spürbaren Aufbruchsstimmung geprägt war. Kennedy ist es gelungen, diese positive Grundstimmung von der Wirtschaft auf die Gesellschaft zu übertragen.
Dadurch wurde er zum Vorbild für eine ganze Generation vor allem junger Menschen, die sich angesichts der Entspannung am Arbeitsmarkt auch für sich selbst eine Verbesserung ihrer individuellen Lebenslage erwartete. Natürlich sind nicht alle diese Erwartungen in Erfüllung gegangen. Dennoch steht der Name Kennedy auch heute noch für bestimmte demokratische Werte, soziale Gerechtigkeit, Rassengleichheit und einen besonnenen, intelligenten PolitikerInnentypus, der auch in schwierigen Krisensituationen einen kühlen Kopf bewahren und zu seinen persönlichen Überzeugungen stehen kann.
uni:view: Inwiefern hat die Ermordung Kennedys 1963 zur Mythenbildung beigetragen?
Gärtner: Wahrscheinlich wäre der Mythos nicht in dieser Form entstanden, wenn Kennedy nicht auf derart tragische Art und Weise ermordet worden wäre. Das Attentat selbst ist ja nie endgültig aufgeklärt worden. Das hat zu unzähligen Verschwörungstheorien geführt, in denen die offizielle Version angezweifelt und oft von einer Involvierung von Hintermännern aus den Reihen der CIA, des organisierten Verbrechens oder ausländischer Machthaber ausgegangen wird. Das konnte allerdings niemals bewiesen werden. Schon alleine die Tatsache, dass Kennedy so früh aus dem Leben geschieden ist, hat beim Mythos um seine Person eine große Bedeutung. Wenn er länger regiert hätte – vielleicht ein oder sogar zwei Amtsperioden –, hätte ihn die Realität vermutlich ebenso eingeholt wie viele andere Präsidenten. Dann wäre wohl auch viel vom Glanz seines Mythos wieder verschwunden.

"Bei der Ermordung John F. Kennedys war ich gerade einmal zehn Jahre alt. Das Attentat war für viele ein Schock. Seine Aufarbeitung hat sich lange hingezogen – jeder wollte wissen, wer dahintersteckt", so der Politikwissenschafter Heinz Gärtner. (Foto: Heinz Gärtner)
uni:view: Wenn wir versuchen, den Mythos beiseite zu lassen – was hat die Politik Kennedys inhaltlich ausgezeichnet?
Gärtner: Hier sind im Wesentlichen zwei Bereiche zu unterscheiden: sein innenpolitisches und sein außenpolitisches Engagement. Bleiben wir zunächst bei der Innenpolitik: Im eigenen Land hat sich Kennedy vor allem dadurch hervorgetan, dass er den Mut hatte, bestimmte Themen offen anzusprechen und sie nicht wie seine Vorgänger totzuschweigen. So zeigte er etwa keine Scheu, die soziale Ungerechtigkeit im eigenen Land aufzuzeigen und zu kritisieren oder ein Ende der Rassentrennung zu fordern. Auch wenn er viele dieser Probleme während seiner Amtszeit noch nicht lösen konnte, hat er doch einige wichtige Entwicklungen und Reformen, die erst später umgesetzt werden konnten, zumindest angestoßen. Ein Beispiel hierfür wäre etwa der Civil Rights Act und das Sozialprogramm Great Society, die erst unter seinem Nachfolger Lyndon Johnson in Kraft getreten sind.
uni:view: Und wie stand es um seine Außenpolitik?
Gärtner: Kennedys Außenpolitik war vor allem von internationalen Krisen geprägt. Ob Berlin oder Kuba – in fast allen Fällen ist es ihm gelungen, sich gegen den Druck des Militärs durchzusetzen und eine direkte militärische Intervention der USA zu verhindern. Bei der Berlinkrise hat er etwa sehr zurückhaltend agiert. Den Bau der Berliner Mauer verurteilten die USA zwar, doch Kennedy war nicht bereit, ein bis zwei Millionen AmerikanerInnen zu opfern, damit Deutschland wieder vereint werden kann. Auch in Vietnam lehnte er wiederholte Forderungen seiner militärischen Berater ab, eine größere Anzahl von Bodentruppen auszuschicken.
Was die Kubakrise betrifft, zeigt die moderne Geschichtsforschung ein zweischneidiges Bild: Einerseits hat Kennedy zwar mit seiner standhaften Haltung eine direkte Intervention und somit einen möglichen atomaren Krieg abgewendet, andererseits hat er aber auch Fehler begangen. Sein größter war mit Sicherheit die Invasion in der Schweinebucht 1961, die den Sturz von Fidel Castros Revolutionsregierung zum Ziel hatte. Die Aktion endete als völliger Fehlschlag und als schwere internationale Blamage für die USA. Auch dass sich Kennedy während der 13 Tage des Raketen-Pokerspiels mit dem damaligen sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow standhaft durchgesetzt haben soll, stimmt nur teilweise. Fest steht, dass er große Angst vor einer atomaren Eskalation hatte. Mittlerweile sind Dokumente einsehbar, die eindeutig belegen, dass seine Militärs es durchaus in Kauf genommen hätten, wenn der Großteil der US-Ostküste durch einen Atomschlag der UdSSR vernichtet worden wäre.
uni:view: Hätte es Kennedy damals also nicht gegeben, wäre die Welt tatsächlich in einen atomaren Krieg geschlittert?
Gärtner: Bei allen großen Krisen, in denen die USA und die UdSSR direkt involviert waren, haben beide Seiten tendenziell sehr vorsichtig agiert. Sie gingen zwar oft bis an die Grenze der gegenseitigen Provokation, letzten Endes hat man sich dann aber doch immer zurückgehalten. Dass die Kubakrise nicht in einem atomaren Desaster endete, ist also nicht einzig und allein auf das Verhandlungsgeschick Kennedys zurückzuführen – auch wenn das heute oft gerne so dargestellt wird. Beide Supermächte wussten sehr genau, dass mit einem atomaren Schlag die gegenseitige Vernichtung drohte und dass davon keine der beiden Seiten profitieren würde.
Der Kalte Krieg ist nicht bloß ein historisches Relikt. Ob der Ukraine-Konflikt, der syrische Bürgerkrieg oder die Spannungen mit Nordkorea – die Welt ist auch heute noch geprägt durch die einst geschaffenen Verhältnisse. In seinem Buch "Der Kalte Krieg" bietet Heinz Gärtner eine Übersicht der politischen Entwicklungen von 1945 bis 1989/90 und wagt einen Ausblick in unsere nahe Zukunft.
uni:view: Auffällig ist, dass Kennedy nicht erst nach seinem Tod, sondern schon zu Lebzeiten wie ein Popstar verehrt worden ist. Liegt das auch an seiner gekonnten Medieninszenierung?
Gärtner: Ja, sein Popstar-Status geht zu einem großen Teil darauf zurück, dass Kennedy das Potenzial des Massenmediums Fernsehen früh erkannt hat und für sich zu nutzen wusste. In puncto Medieninszenierung war er den meisten seiner politischen Konkurrenten weit voraus. Nehmen wir etwa Nixon: Er konnte mit den Medien nicht gut umgehen und wusste nicht so recht, wie er sich verhalten soll. Dieser Unterschied ist bei der damaligen TV-Debatte zwischen Nixon und Kennedy deutlich zu Tage getreten. Das war schlussendlich auch mit ein Grund, warum sich Kennedy bei der Präsidentschaftswahl knapp durchsetzen konnte.
Ein weiterer Faktor war sicherlich auch sein rhetorisch versiertes Auftreten und seine junge, attraktive Erscheinung. Aber auch Kennedy hat vieles kaschiert: Er war ja eigentlich todkrank, konnte nicht lange stehen und war von Anfang an mit Medikamenten vollgepumpt. Doch das eigene Volk wusste davon nichts. Diese Dinge wurden bewusst verheimlicht, um sein Image als junger, dynamischer und kämpferischer Politiker nicht anzukratzen.
uni:view: Das jüngste Präsidentschaftsduell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton ging als schmutzigster Wahlkampf in die US-Geschichte ein, bei dem beide Kontrahenten versuchten, auch private Themen öffentlich auszuschlachten. Warum wurde das damals nicht auch bei Kennedy versucht, Angriffspunkte gab es ja genug?
Gärtner: Zur Zeit Kennedys hat man über gewisse private Dinge einfach nicht gesprochen. Heute ist das anders, dafür fällt es einem zunehmend schwerer, sich ein ausgewogenes Bild der tatsächlichen Verhältnisse zu machen. Es werden ständig irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt und niemand kann genau sagen, was dahintersteckt. Wie sollen "normale" BürgerInnen bei all den Informationen und Fehlinformationen, die in den Medien zu finden sind, heutzutage richtig beurteilen können, was stimmt und was nicht? Ich würde sagen, dass die Medien nicht immer zur Wahrheitsfindung beitragen, sondern diese vielleicht sogar noch erschweren.
uni:view: Wenn wir schon beim amtierenden US-Präsidenten sind – was sind die größten Unterschiede zwischen Trump und Kennedy?
Gärtner: Man muss schon bedenken, dass die 1960er Jahre eine ganz andere Zeit waren. Damals musste ein Präsident noch ein Staatsmann sein, der eine gewisse Vorbildwirkung haben sollte. Das hat Kennedy in seiner kurzen Amtszeit seht gut verkörpert, was ihm sowohl national als auch international eine große Akzeptanz und Achtung eingebracht hat. Trump spricht im Unterschied zu Kennedy mit seinen Themen nur einen bestimmten Teil der US-Bevölkerung an – ihm genügt das. Er hat auch von sich aus gar kein Interesse daran, als Staatsmann im traditionellen Sinn angesehen zu werden. Kennedy war zudem auch jemand, der das politische Geschäft von klein auf gelernt hat. Auf Trump trifft das überhaupt nicht zu. Kennedy war trotz des Kalten Krieges offen für die Welt, für Veränderungen und Wissenschaft. Trump ist nationalistisch und skeptisch gegenüber Wissenschaft.
uni:view: Gab oder gibt es in Europa PolitikerInnen, die mit Kennedy vergleichbar sind? Und: Was könnten sich heutige PolitikerInnen von Kennedy abschauen?
Gärtner: Was seine Rhetorik, sein Auftreten und sein globales Denken betrifft, war Kennedy durchaus auch mit einem Bruno Kreisky in Österreich zu vergleichen: beide haben sich entschieden gegen direkte militärische Interventionen ausgesprochen und beide standen für einen gemäßigten Anti-Kommunismus. Natürlich war die Situation in den USA und in Österreich völlig unterschiedlich und es liegen auch zehn Jahre zwischen beiden Politikern. Wenn es aber um heutige PolitikerInnen im Allgemeinen geht, könnten sich einige durchaus in manchen Dingen eine Scheibe von Kennedy abschneiden. Auch wenn er es in seiner kurzen Amtszeit nicht geschafft hat, eine echte Revolution herbeizuführen – er hatte den Mut, unangenehme Themen offen anzusprechen, seinen Überzeugungen auch in schwierigen Situationen treu zu bleiben und sich nicht von anderen in einen Krieg treiben zu lassen.
uni:view: Vielen Dank für das Gespräch! (ms)
Mehr über Heinz Gärtner:
Univ.-Prof. Dr. Heinz Gärtner ist Professor für Politikwissenschaft. Er ist Lektor an der Diplomatischen Akademie Wien und an der Donau Universität Krems. Er ist Vorsitzender des Beirates für "Strategie und Sicherheit" der Wissenschaftskommission des Österreichischen Bundesheeres und Mitglied des Beirats des "International Institute for Peace" (IIP) in Wien. Zudem ist er Affiliated Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip), bei dem er bis 2016 wissenschaftlicher Direktor war.