Uni:Blicke: Österreich braucht Forschung
Redaktion (uni:view) | 23. Mai 2012Am Dienstag, 22. Mai, sprachen Rektor Heinz W. Engl, ÖAW-Präsident Helmut Denk und IST Austria-Präsident Thomas A. Henzinger mit Bundesminister Karlheinz Töchterle und erfolgreichen ERC Grant-PreisträgerInnen über exzellente Grundlagenforschung in Österreich. Einige Eindrücke von der Veranstaltung.

Die Veranstaltung "Österreichische Spitzenforschung durch EU-Gelder fördern – ERC Grants" fand am Dienstag, 22. Mai 2012, um 11.30 Uhr im Kleinen Festsaal der Universität Wien statt. V.l.n.r.: Rektor Heinz W. Engl, Helmut Denk, Präsident der ÖAW, Thomas A. Henzinger, Präsident des IST Austria sowie Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle.
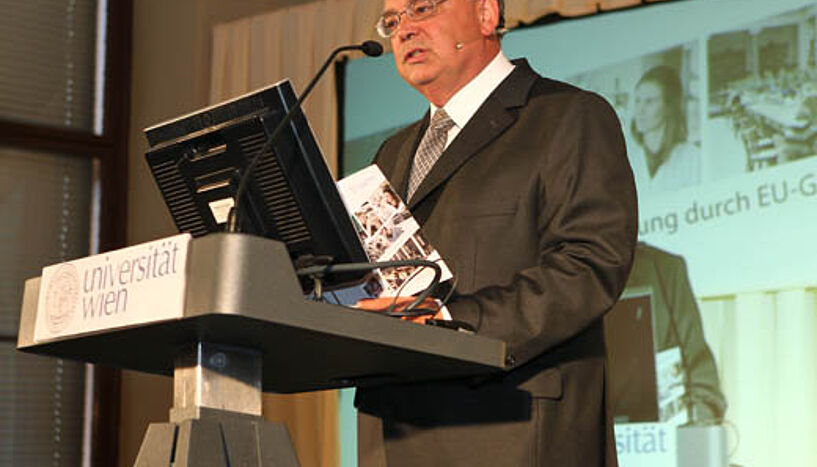
Nach einer Begrüßung durch Rektor Heinz W. Engl stellten ERC-PreisträgerInnen der Universität Wien, der ÖAW und des IST Austria sich und ihre ERC-Projekte vor und gaben Statements zur Bedeutung dieser höchsten EU-Forschungsförderung für die Grundlagenforschung in Österreich ab.

Den Beginn machte Goulnara Arzhantseva von der Fakultät für Mathematik der Universität Wien, die im Rahmen ihres ERC Starting Grants neue Konzepte und Techniken in der geometrischen und asymptotischen Gruppentheorie entwickelt, die zur Etablierung eines neuen Forschungszweigs führen – der analytischen Gruppentheorie. Sie bezeichnete die Forschung im Rahmen eines ERC Grants als Abenteuer und sprach von wissenschaftlichen Träumen, die durch Förderungen wie den ERC Grant, welche unabhängige Forschung und forscherische Freiheit erlauben, realisiert werden können.

Ihr folgte ERC Advanced Grant-Preisträger und Quantenphysiker Anton Zeilinger. Er sieht die Stärke des ERC Grants darin, dass diese Förderung das Einschlagen völlig neuer wissenschaftlicher Wege zulässt und den Grantees erlaubt, unerwarteten Ergebnissen nachzugehen, auch wenn sich dadurch die ursprünglich eingereichte Idee verändert. ERC Grants würden auch nicht vorhersehbare Entwicklungen zulassen. Zeilinger bedankte sich bei der Universität Wien, die ihn und seine Gruppe wesentlich bei der Antragstellung unterstützt habe.

Nach Zeilinger betrat der Teilchenphysiker und ERC Advanced-Grantee Eberhard Widmann, Direktor des Stefan-Meyer-Instituts für subatomare Physik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Podium. In seinem ERC-Projekt "Hyperfine Structure of Antihydrogen HBAR-HFS" soll die sogenannte Hyperfeinaufspaltung des Grundzustands von Antiwasserstoff gemessen werden. Ziel ist es, das Verständnis der Teilchenphysik zu erweitern und fundamentale Fragen der Kosmologie zu beantworten. Widmann betonte, dass nur innerhalb internationaler Kollaborationen effektiv an vorderster Front geforscht werden kann. Einen ERC Advanced Grant erhalten zu haben, sei für ihn nicht nur die Anerkennung jahrelanger Forschungstätigkeit, sondern ermögliche ihm auch den Ausbau seiner Arbeitsgruppe auf international konkurrenzfähigem Niveau.
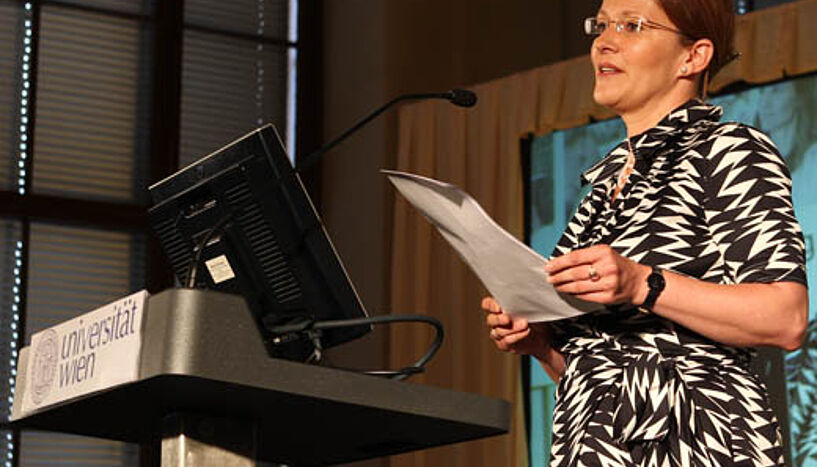
Seine ÖAW-Kollegin Pavlína Rychterová, die am Institut für Mittelalterforschung die Arbeitsgruppe Volkssprachliche Texte leitet und 2010 einen ERC Starting Grant erhalten hat, machte den Aspekt des Reisens zum Thema: Denn u.a. bietet ein ERC Grant den Forschenden die Möglichkeit, die Forschungsstätte frei zu wählen – für Pavlína Rychterová ein wesentlicher Vorteil des Förderinstruments. Sie betonte, dass der Erfolg des Weges, den ein/e ERC-PreisträgerIn einschlägt, wesentlich von der Institution mitbestimmt wird, an der die Förderung ansiedelt ist. Wien sei für sie der ideale Forschungsstandort, der fast alle Bedingungen erfülle, die man sich als ERC-Grantee wünsche, wie etwa u.a. eine geistig inspirierende Umgebung, hilfsbereite KollegInnen, selbständige und fleißige MitarbeiterInnen, eine aufgeschlossene Verwaltung, aber auch attraktive kulturelle und kulinarische Angebote. Für Rychterová, die sich selbst als "wissenschaftliche Reisende" bezeichnet, macht v.a. die Lehre einen Forscher oder eine Forscherin aus: "Forschung ist nicht erst durch ökonomischen Nutzen oder mediale Aufmerksamkeit von Wert, sondern dann, wenn sie Menschen zum bewussten, verantwortungsvollen Gebrauch des Verstands erzieht."

Danach stellte Neurowissenschafter und ERC Advanced Grant-Preisträger Peter Jonas vom IST Austria, der die "Nanophysiology of fast-spiking, parvalbumin-expressing GABAergic interneurons" erforscht, sein Projekt vor. Der ERC Grant war nicht nur für seine wissenschaftliche Karriere wichtig, sondern auch für die Etablierung einer neuen Forschungsrichtung am IST Austria. Jonas betonte die Bedeutung von ERC Grants für den Aufbau neuer, interdisziplinärer Forschungsstrukturen.

Seine IST Austria-Kollegin, die Evolutionsbiologin Sylvia Cremer, untersucht im Rahmen ihres ERC Starting Grants kooperative Mechanismen zur Abwehr von Krankheitserregern bei Ameisengesellschaften. Sie hat im Laufe ihrer wissenschaftlichen Karriere bereits verschiedene EU-Förderprogramme wie das TMR-Programm (Training and Mobility of Researchers) oder den Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) durchlaufen. Nach Wien zog es sie u.a. aufgrund des attraktiven Forschungsnetzwerks in der Wiener Region (EvolVienna), an dem auch zahlreiche ERC-Grantees beteiligt sind. Ein ERC Grant biete WissenschafterInnen eine langjährige Perspektive sowie den Aufbau eines Teams und ermögliche Hochrisikoforschung sowie große Flexibilität. Bei der Bewerbung sei es jedoch auch wichtig, auf die Unterstützung von KollegInnen sowie nationalen Kontaktstellen sowie den entsprechenden Stellen an der jeweiligen Institution zählen zu können.

Nach den Kurzreferaten startete die Diskussion mit Rektor Heinz W. Engl, Helmut Denk, Präsident der ÖAW, Thomas A. Henzinger, Präsident des IST Austria sowie Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle. Der Moderator Martin Haidinger vom ORF begann mit der provokativen Einstiegsfrage, ob es überhaupt realistisch sei, dass Österreich an der europäischen Spitze mitmischen kann – "oder sind wir nur ein Forschungsbinnengewässer abseits des Ozeans der Großen?" Bundesminister Töchterle wunderte sich über die Frage. Bestes Beispiel seien doch die eben präsentierten Projekte aus der Forschung, die ReferentInnen selbst sowie die Gruppen und Institutionen, die hinter den ERC-PreisträgerInnen stehen. Österreich mische bereits an der Forschungsspitze mit, etwa kämen internationale ForscherInnen mit ihren ERC Grants nach Österreich.

IST Austria-Präsident Thomas A. Henzinger (im Bild) fügte u.a. hinzu, dass exzellente Forschung kein Privileg großer Nationen sei, wie die Beispiele Schweiz, Niederlande oder Schweden zeigen. "Wir haben in Österreich nicht nur in Euros, sondern auch in ForscherInnen eine positive Bilanz", sagte er. ÖAW-Präsident Helmut Denk meinte dazu u.a., dass es sich Österreich gar nicht leisten könne, mittelmäßige Forschung zu fördern: "Wir können nur exzellente Forschung fördern."

Rektor Heinz W. Engl (im Bild) erklärte, dass Forschung ohnehin nicht auf Binnengewässern, sondern überhaupt nur auf dem internationalen Ozean funktionieren kann. Über den Hintergrund der zahlreichen erfolgreichen österreichischen ERC-Einwerbungen erklärte Rektor Engl, dass es seit 2000 eine Verstärkung der Grundlagenforschung gegeben habe, u.a. im Rahmen von FWF-Förderungen wie Spezialforschungsbereichen, Doktoratskollegs etc.: "Erst auf dieser Basis kann man ERC Grants einwerben und in der Zukunft kompetitiv sein. Auch weiterhin muss Forschung an den Universitäten in Gang gebracht werden, damit wir in fünf Jahren wieder hier sitzen und unsere ERC Grants feiern können", so der Rektor.

Auf die Frage des Moderators, ob ein kleines Land wie Österreich stärker fokussierte Schwerpunkte brauche als eine große Forschungsnation, meinte Bundesminister Töchterle (im Bild), dass sich Schwerpunkte in Kombination von Bottom Up- sowie Top Down-Prozessen entwickeln müssen. Eine Forschungsgruppe könne einerseits sehr wohl aus sich selbst heraus stark werden, die Wissenschafts- bzw. Universitätspolitik sei auf der anderen Seite gefordert, an der Schwerpunktsetzung mitzuwirken. Für letzteres sei der Hochschulplan ein gutes Instrument. Weiters müsse auch eine gewisse Breite in der Lehre gegeben sein, um einen fruchtbaren Boden für Entwicklungen von unten zu bilden. Auch Rektor Engl sprach sich für eine Mischung aus Bottom Up- und Top Down-Prozessen aus. Als Kriterien für die Ausbildung von erfolgreichen Schwerpunkten nennt er die Finanzierungsstruktur, die ausreichende Grund- bzw. Startfinanzierung von Forschungsvorhaben – im Sinne einer Vollkostenfinanzierung in der Forschung – ergänzt durch eine Studienplatzfinanzierung.

Helmut Denk (im Bild) schließt sich den Vorrednern an und betont, die Schwerpunktsetzung an sich müsse von unten kommen. Zwar brauche man heutzutage aufgrund der Budgetsituation eine Art Korsett bzw. Rahmenbedingungen, aber "es muss eine Freiheit geben, in der Forschung Richtungen zu verfolgen, die man nicht vorhersehen kann." Thomas A. Henzinger nennt dazu als Beispiel, dass sich bei der Gründung des IST Austria niemand gedacht hätte, dass die Computer Sciences einmal einen Schwerpunkt des Instituts bilden würden. Genau in diesem Bereich seien aber derzeit drei ERC Grants angesiedelt.
Zur Entwicklung der Forschungsförderung in Österreich meinte Rektor Engl: "Die ERC Grants sind die Spitze des Eisberges; um solche Top-Förderungen zu erreichen, braucht man eine solide, kompetitive Grundfinanzierung der Forschung an den Universitäten, darüber hinaus benötigen wir einen gestärkten FWF bis hin zu einer Exzellenzinitiative." Bundesminister Töchterle verwies darauf, dass für eine gesonderte Exzellenzinitiative bisher noch keine zusätzlichen Mittel aufgestellt werden konnten: "Ich werde mich bemühen, hier etwas zu bewegen." Weiters betonte der Minister die Erfolge heimischer WissenschafterInnen im derzeit laufenden 7. EU-Forschungsrahmenprogramm: Die Rückflussquote Österreichs liegt bei 128 Prozent.

Abschließend formulierte der Moderator seine Eingangsfrage um und fragte, ob der Griff nach den "Sternen der EU-Förderungen" also in Österreich ein realistischer sei? Rektor Engl bejahte dies und betonte, dass sein Vorgänger Georg Winckler im Jahr 2010 60 Berufungen durchgeführt habe. Die Universität Wien sei trotz Budgetproblemen für internationale WissenschafterInnen anziehend. Österreich sei ein attraktiver Forschungs- und Universitätsstandort. "Wir sind gut. Wir brauchen eine ausreichende finanzielle Ausstattung, um weiterhin so gut bleiben zu können." (Fotos: Jürg Christandl)
Die Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie demnächst im Medienportal unter Webstreams zum Nachsehen.
