Sommerpost: Mittelalterliche Burgen, Ötzi und die Römer
Gastbeitrag von Alois Stuppner | 07. September 2011Eine zwölftägige Auslandsexkursion des Instituts für Ur- und Frühgeschichte führte 22 Studierende unter der Leitung von Alois Stuppner nach Oberitalien in die Region Trentino-Südtirol. Unter dem Titel "Archäologie der südlichen Zentralalpen" erkundeten die Studierenden die eisenzeitliche Besiedlung, Städte, Siedlungen und Gräberfelder sowie Straßen und Straßenstationen der Römerzeit, langobardenzeitliche Castra und vorromanische Kirchenbauten. Neben aktuellen Ausstellungen – wie 20 Jahre Ötzi-Forschung – lernten sie auch die Methoden der Bodendenkmalpflege sowie neu geschaffene Archäologieparks näher kennen.

Das antike Sebatum, benannt nach den vorgeschichtlichen Bewohnern Saevates, war eine bedeutende römische Straßenstation (mansio) im westlichen Pustertal im Bereich der heutigen Ortschaft St. Lorenzen nahe bei Bruneck. Die ersten systematischen Ausgrabungen führte das königliche Denkmalamt von Padua in den Jahren von 1938 bis 1940 durch. Neben Privathäusern, Bädern und Werkstätten konnte der mächtige Bau einer Markthalle (marcellum) freigelegt werden. Einige dieser Grundrisse – auch aus neueren Ausgrabungen – sind im Gelände sichtbar. Von 2000 bis 2002 wurde ein bedeutendes Gräberfeld vom 1. bis 5. Jh. n. Chr. in der Pichlwiese freigelegt, deren wertvollen Funde im Antiquarium von St. Lorenzen betrachtet werden konnten. Ein archäologischer Panoramaweg mit 16 Schautafeln rundete die Spuren zur Besiedlungsgeschichte der Gegend ab.

Ein Zentrum für die Vermittlung der Geschichte Ladiniens ist das "Museum Ladin – Ćiastel de Tor" in St. Martin in Thurn im Gadertal. Archäologisch beinhaltet das Museum eine Ausstellung und Funde zu den mesolithischen Fundstellen in den Dolomiten und der bisher einzigen in den Dolomiten flächig untersuchten bronzezeitlichen befestigten Höhensiedlung Sotćiastel, die etwa zwischen 1600 und 1250 v. Chr. bestand. Ein 3D-Modell (im Bild) und zahlreiche Funde geben einen Einblick in die Siedlungsstruktur, die Bedeutung der Siedlung und die Lebensumstände der damaligen Zeit.

Die Mühlbacher Klause in der Talenge Haslach östlich von Mühlbach hatte vielfältige historische Funktionen und Bedeutungen. Sie war antike und mittelalterliche Grenzscheide und militärische Talsperre, Zollstätte, Sitz der niederen Gerichtsbarkeit, Verwaltungsgrenze und Schauplatz der napoleonischen Kriege im Jahr 1809. Die Ruine wurde von 1997 bis 2003 vorbildlich restauriert. Zu den besonderen Besichtigungsobjekten zählt ein steinerner Zahltisch aus dem Jahre 1477, der von der Funktion als Zollstation der Mühlbacher Klause zeugt.

Der bereits seit den 1930er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannte Abschnitt einer römischen Straße bei Franzensfeste wurde durch jüngste Grabungen weiter freigelegt. Deutlich sind die Spurrillen für die Karren im Felsen zu sehen. Die Straße wurde zwischen dem 1. und 4. Jh. n. Chr. durch das Eisacktal nach Augusta Vindelicorum (Augsburg) angelegt. Das Besichtigungsobjekt ist mittlerweile 100 m lang und wird als Archeoparc Franzensfeste präsentiert.

Die mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Ausgrabungen in Feldthurns/Tanzgasse südlich von Brixen sind im Archeoparc Feldthurns für Besichtigung und Studium öffentlich frei zugänglich. In der späten Kupferzeit, der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausend v. Chr., wird der als Megalithanlage gestaltete Kultplatz aus Grabhügeln als Begräbnisort genutzt. Neben Siedlungsnachweisen aus der Bronze-, Eisen und Römerzeit konnte auch der Grundriss eines spätantiken Wohnhauses des 4. bis 5. Jh. n. Chr. verfolgt werden, von dem ein Mauersockel aus mit Lehm verbundenen Steinen sowie eine zentrale Feuerstelle erhalten geblieben sind.

Säben war im Frühmittelalter ein bedeutender Bischofssitz. Hans Nothdurfter, Ausgräber von Säben, legte anhand von Plänen den Befund der frühchristlichen Kirche dar und informierte über den frühmittelalterlichen Bischofssitz, deren Anfänge ins 6. Jahrhundert zurückreichen, sowie die mittelalterliche Burganlage. Die erste Kirche wurde schon 1929/30 an der Südseite des Säbener Hügels ausgegraben, deren älteste Bauphase bis ins 4. Jh. n. Chr. zurückreichen dürfte. Sie ist mit einer freistehenden Priesterbank ausgestattet. Unterhalb der Kirchenanlage wurde ein Reihengräberfeld freigelegt, in dem sowohl Romanen wie Germanen bestattet waren.

Unter einem Glas- und Stahlgerüst sind die Mauern und Inneneinrichtungen – wie der Herd im Bild – eines römischen Landhauses, das zu Beginn des 3. Jh. n. Chr. errichtet worden ist, konserviert. Das herrschaftliche Gebäude wies Türschwellen aus Trentiner Marmor auf. Der Besitzer hat hier ein seinem Status entsprechendes Wohnhaus errichten lassen.

Seit der Bronzezeit bestand auf dem Peterbühel in Völs am Schlern ein Siedlungszentrum. Hans Nothdurfter wies bei der Führung vor allem aber auf Reste von Gebäuden der jüngeren Eisenzeit mit vier Brandkatastrophen vom 6. Jh. v. Chr. bis in die augusteische Zeit hin, deren Grundrisse im Gelände als eingetiefte große Gruben erkennbar sind. Außer vereinzelten Funden der mittleren und späten Eisenzeit sei eine mächtige Befestigungsanlage des Frühmittelalters mit zwei konzentrischen Mauerringen hervorzuheben.

Roland Messner führte durch das Fundarchiv und die Restaurierungswerkstätten des Amtes für Bodendenkmäler in Bozen. Er informierte über das System der Fundverwahrung und -verwaltung, die Methoden der Restaurierung, die Einrichtungen wie Graphik- und Fotoabteilung. Mit großem Interesse wurden von den ExkursionsteilnehmerInnen die für das neue Römermuseum vorbereiteten Funde der Mansio Sebatum in St. Lorenzen begutachtet.

Der z.T. natürlich geschützte Vigiliusbühel von Perdonig trägt Befestigungsanlagen aus der Völkerwanderungszeit und des Frühmittelalters. Es können im Gelände noch die Reste und Verlauf der Befestigungsmauern sowie die an die Innenseite angelehnten Gebäude (Kasematten) verfolgt werden. Der höchste Gebäuderest sind die Ruinen der alten Kirche zum Hl. Vigilius (Bischof von Trient, gest. 405 n. Chr.). Die erhaltenen Mauern ermöglichten einen besonderen Einblick in die frühmittelalterliche Mauertechnik.

Etwa einen Kilometer unterhalb von Schlaneid bei Mölten steht am Rand des steil ins mittlere Etschtal abfallenden Berges die Ruine der ehemaligen Valentinskirche, die 1769 nach einem Brand abgerissen wurde. Der Patron der Kirche, der heilige Valentin, war Bischof von Rätien, kam von Passau nach Mais und starb am 7. Jänner 475 n. Chr. Im Jahr 769 wurden die Gebeine von Tassilo III nach Passau überführt. 1990 und 1991 wurden Ausgrabungen durchgeführt, die unter der Steinkirche (im Bild) eine frühmittelterliche Holzkirche des 6./7. Jh. n. Chr. zum Vorschein brachten.

Ein Tag der Exkursion war der ur- und frühgeschichtlichen Forschung im Vinschgau gewidmet. Nach den Besichtigungen von St. Prokulus in Naturns und St. Benedikt in Mals, jeweils mit Führung durch Hans Nothdurfter, wurden die aktuellen Ausgrabungen in Mals besucht. Diese werden im Rahmen des neuen, seitens des Landes Südtirol genehmigten Projekts "Die Römerzeit im oberen Vinschgau – Ein Beitrag zur römischen Siedlungstopographie einer alpinen Gebirgsregion", durchgeführt. Stephan Leitner von der Universität Innsbruck, Grabungsleiter vor Ort, führte durch die erst begonnenen Ausgrabungen (im Bild). Ziel des Projekts ist die Erforschung der Siedlungsgeschichte einer einzigartigen Kulturlandschaft, wie jene der Malser Haide, um einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des lückenhaften Wissensstands über die Römerzeit im Vinschgau zu liefern.

Zentrales Ausstellungsobjekt im Vinschger Museum von Schluderns sind die Ergebnisse der Forschungen auf dem Ganglegg oberhalb von Schluderns am Ausgang des Matschertales, einer bronze- und eisenzeitlichen befestigten Kuppen- und Zentralsiedlung. Neben den Funden von Ganglegg konnten auch die verpackten Funde aus der Römerzeit und des frühen Mittelalters (im Bild) der Sonderausstellung "Zurück ans Tageslicht", die im Kloster Marienberg oberhalb von Burgeis im Vinschgau bis 6. November 2010 zu sehen war, besichtigt werden.

Jürg Goll, Bauhüttenmeister und Mittelalterarchäologe, präsentierte ein umfassendes Bild des früh- und hochmittelalterlichen Klosters St. Johann in Müstair, das eine Stiftung Karls des Großen ist und karolingische Fresken aus der Zeit um 800 in der Klosterkirche beherbergt. Er führte durch die aktuellen Restaurierungsarbeiten und Ergebnisse der Bauuntersuchungen der Kreuzkapelle.

Die Ruine der dreischiffigen Petruskirche liegt auf einem Porphyr-Hügel unterhalb der Ortschaft Altenburg bei Kaltern. Sie gehört zu den ältesten Kirchen in der Region, wurde im 5. bzw. 6. Jh. n. Chr. errichtet und auch für Bestattungszwecke verwendet. Von den Inneneinrichtungen sind eine Priesterbank, ein Altar, eine Reliquiengrube und ein Ambo nachgewiesen.

Im Museo Civico von Rovereto wurden wir durch die Archäologin des Museums, Barbara Maurina, empfangen (Bild: zweite von links). Sie präsentierte die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen auf der Isola San Andrea am See von Loppio in der Gemeinde Mori. Die Ausgrabungen ergaben eine befestigte Siedlung mit Holzhütten aus dem Ende des 5. oder Anfang des 5. Jh. n. Chr., die in der ersten Hälfte des 6. Jh. n. Chr. durch Steinbauten ersetzt wurden und bis zum Beginn des 7. Jh. n. Chr. bestanden hat. Barbara Maurina vermutet in der Anlage aufgrund von langobardenzeitlichen Militaria das bei Paulus Diaconus überlieferte Castrum Bremtonicum, das 590 durch Franken zerstört wurde. Leider konnten wir den Fundort aus denkmalpflegerischen Gründen nicht aufsuchen.

Joachim Thaler, einer der Teilnehmer (Bild: erster von rechts), hatte sämtliche Informationen aus der italienischen Fachliteratur zu dem römischen Höhenheiligtum auf dem Monte San Martino bei Riva zusammengetragen und präsentierte die Ergebnisse zu den Ausbau- und Umbauphasen sowie der Funktion der Anlage anhand der konservierten Mauerruinen vor Ort.

Nach einem 50-minütigen Fußmarsch erreichten wir die Überreste einer befestigten Siedlung aus der spätantik-frühmittelalterlichen Zeit auf dem Berg Monte San Martino, ein strategischer und grandioser Aussichtspunkt nahe der Ortschaften Lundo und Lomaso in 980 m Meereshöhe. Der Fundort liegt auf einer Route, die in der Antike die zentralen Alpen mit der Region am Gardasee und der Poebene verband. Mitarbeiter des Grabungsteams von Enrico Cavada der Universität Trient führten und informierten über die aktuellen Forschungen. An dem 2008 begonnenen Forschungsprojekt beteiligt sich auch die "Kommission zur vergleichenden Archäologie römischer Alpen- und Donauländer" der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. An der höchsten Stelle des Berges sind ein Abschnitt der Befestigungsmauer mit Strebepfeiler in regelmäßigen Abständen (Bild), ein viereckiger Turm sowie im östlichen Bereich der Anlage die Mauerruinen der kleinen Kirche von San Martino, die im 5./6. Jh. n. Chr. erbaut und im 11./12. Jh. neu errichtet wurde, konserviert.

Nach dem Zusammenbruch der römischen Grenzen hat sich die Bevölkerung von Trient in der 2. Hälfte des 6. Jh. n. Chr. auf das Felsplateau im Westen der Stadt zurückgezogen. Elisa Possenti von der Universität Trient führte durch die Grundrisse der frühchristlichen Basilika auf dem Dos Trento (Bild). Als Patrozinium wird Cosmas und Damian vermutet. Anschließend wurden in einem archäologischen Rundgang die außen an der Kirche S. Apollinare angebrachte Inschriftentafel, die das älteste Zeugnis von Tridentum aus dem Jahre 23 v. Chr. darstellt, und weitere Ausgrabungsorte des Projektes "Tridentum. Die unterirdische Stadt" besichtigt, das der römische Kaiser Claudius als splendidum municipium bezeichnete.

Ausgewählte Besichtigungspunkte des unterirdischen Tridentums waren das unterirdische archäologische Gelände des SAS, wo ein Stück der römischen östlichen Stadtmauer, eine gepflasterte Straße, Bereiche von Häusern mit Resten von Mosaiken, Höfen und Handwerksläden gezeigt werden, die Porta Veronensis, der monumentale südliche Zugang zur Stadt ab der Mitte des 1. Jh. n. Chr. und die außerhalb der römischen Stadtmauer errichtete frühchristliche Basilika unter dem heutigen Dom des Hl. Vigilius (Bild). Vigilius, der Bischof von Tridentum, ließ an der Stelle eine Begräbnisstätte für die drei Missionare Sisinnius, Martyrius und Alexander, die am 29. Mai 397 in Sanzeno im Nonstal getötet worden waren, errichten. Nach seinem Tod im Jahre 406 n. Chr. wurde auch er an ihrer Seite beigesetzt.
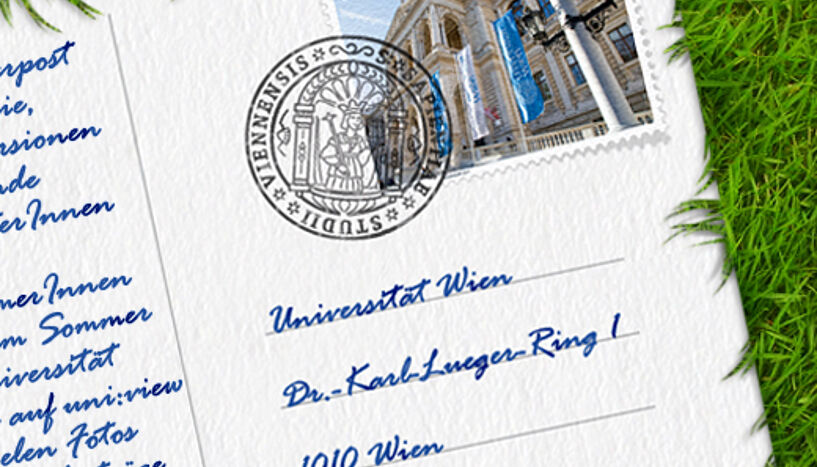
In der uni:view-Sommerserie "Sommerpost" berichten Lehrende und Studierende von spannenden Exkursionen und lassen so die "Daheimgebliebenen" an ihren Lehr- und Lernerfahrungen fernab des Hörsaals teilhaben.
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alois Stuppner vom Institut für Ur- und Frühgeschichte leitete die Exkursion "Archäologie der südlichen Zentralalpen" vom 14. bis 25 Juni 2011. Fotografiert hat Martin Gamon von der Interdisziplinären Forschungsplattform Archäologie, Studierender und Teilnehmer der Exkursion.
