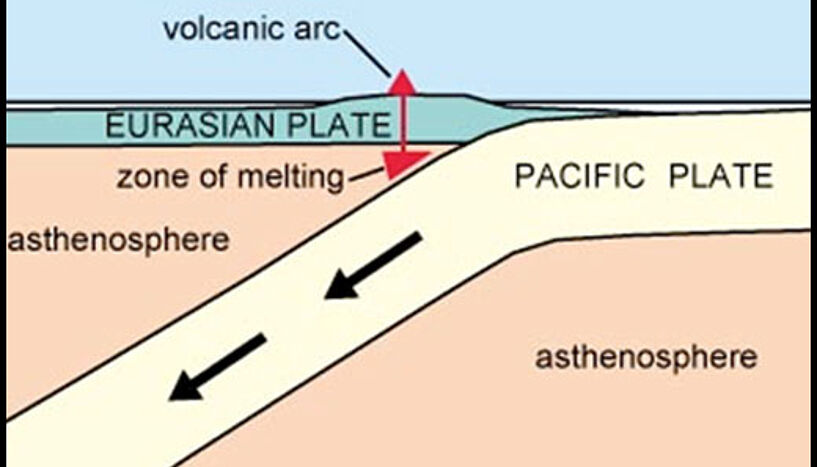Japan-Katastrophe im Blickfeld der Wissenschaft
| 31. März 2011
Am Mittwoch, 30. März 2011, diskutierten Japanologe Sepp Linhart, Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt und Psychologin Brigitte Lueger-Schuster im Hörsaal 33 über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Japan-Katastrophe. Zur ExpertInnen-Runde hatte Götz Bokelmann vom Institut für Meteorologie und Geophysik eingeladen.
Eine "Verdammung Japans" sowie eine "Mythenbildung" ortet Sepp Linhart in der medialen Aufarbeitung der Katastrophe. "Offenbar ist keine unbefangene Auseinandersetzung möglich", kritisierte er bei einer ExpertInnen-Runde zu Japan am gestrigen Mittwoch, 31. März 2011. Psychologin Brigitte Lueger-Schuster erwartet sich eine posttraumatische Belastungsstörung für die japanische Gesellschaft. Dass Naturkatastrophen und Atomunfälle unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet werden, betonte Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt. Veranstaltungsorganisator Götz Bokelmann erklärte, dass die Hälfte der "Megastädte" erdbebengefährdet ist.
Die Verurteilung von Japan als "Atomnation" verdränge in der öffentlichen Aufmerksamkeit die katastrophalen Auswirkungen des Tsunami – "und ignoriert die Tragödie der Erdbebenopfer und Vermissten", sagte der Vorstand des Instituts für Ostasienwissenschaften, Sepp Linhart, gestern im Hörsaal 33 im Rahmen der Informationsveranstaltung zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Japan-Katastrophe. In der Medienberichterstattung habe sich Japan "vom Atomopfer zum Atomtäter" gewandelt: "Man wirft dem Land vor, dass man es nach Hiroshima doch hätte besser wissen müssen". Tatsächlich habe die Geschichte der japanischen Atomnutzung gerade mit einem Lernen aus gefährlichen Technologien zu tun.
Nach dem Wiederaufbau und dem enormen Wirtschaftswachstum sei es zu massiven Umwelt- und Gesundheitsbelastungen durch schmutzige Kohle-Energiegewinnung gekommen. "Ab 1960 stieg man deshalb auf Erdöl und Atom um", so Linhart, der einmal bei einem Studienaufenthalt das erste, 1966 eröffnete Atomkraftwerk in Tokai besucht hat: "Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass Länder wie Großbritannien, Frankreich und die USA als Lieferanten vom Bau der Kraftwerke profitiert haben."
Medien transportieren Mythen
Neben der Verdammung Japans beherrsche aber auch eine "Mythenbildung" die mediale Auseinandersetzung. Die "stoische Ruhe" eines japanischen Samurai sowie "typisch japanische" selbstlose Aufopferung werde verwundert gepriesen. "Warum fliehen sie nicht?", sei Sepp Linhart von JournalistInnen gefragt worden. Die Antwort sei einfach: Könnte man täglich 10.000 Menschen aus dem Raum Tokio evakuieren, würde dies zehn Jahre in Anspruch nehmen. "Das ist also einfach nicht möglich." Das Spannungsfeld zwischen ständiger Bedrohung durch Naturkatastrophen und der Schönheit des Landes gehöre in Japan zum Alltag. Der Berg Fuji sein "ein besonders schönes Symbol dafür".
Gute Voraussetzungen für die psychosoziale Verarbeitung
"Die Fähigkeit der japanischen Gesellschaft, nach der Katastrophe rasch mit Aufräumarbeiten zu beginnen, bietet jedenfalls gute Voraussetzungen für die psychosoziale Verarbeitung", so die Traumaspezialistin Brigitte Lueger-Schuster vom Institut für Klinische, Biologische und Differentielle Psychologie. Durch die "dreifache Traumatisierung" durch das Erdbeben, an das man gewohnt sei, den Tsunami, der in dieser Form ein einzigartiger Schock gewesen sei und die "stille und unabwägbare" atomare Gefahr, ergebe sich eine vielschichtige psychische Dynamik.
Mit den Auswirkungen der Bombenabwürfe von Hiroshima sowie des Erdbebens von Kobe 1995 beschäftigen sich noch heute zahlreiche psychologische Studien. Erst 1998 habe man unter den Hiroshima-Überlebenden psychische Störungen bei mehr als 40 Prozent sowie Amnesie und Schlafprobleme bei mehr als der Hälfte gefunden. Aus der aktuellen Katastrophe sei eine "sehr komplexe posttraumatische Belastungsstörung" für weite Teile der Gesellschaft zu erwarten.
Jeder fühlt sich betroffen
Dass Naturkatastrophen und Atom-Unfälle völlig unterschiedlich wahrgenommen, verarbeitet und beurteilt werden, betonte auch Ulrike Felt, Vorständin des Instituts für Wissenschaftsforschung. "Nukleare Krisen werden seit Tschernobyl nicht mehr lokal gedacht. Gibt es sie an einem Ort, gibt es sie überall. Jeder fühlt sich betroffen." Kritisch sehen müsse man dabei allerdings den Ruf nach besserer Informationspolitik. "Kommunikation ist ein inhärentes Problem von Risikosituationen" - weil die Vielfalt von Faktoren, Indikatoren und ihrer Kombinationen nicht in der notwendigen Einfachheit dargestellt werden kann. Grafiken, auf denen sich Strahlung in konzentrischen Kreisen ausbreitet oder bunte Skalen, auf denen sich Atomunfälle nach Schwere einordnen lassen, würden eine "vorgetäuschte Sauberkeit" erschaffen, so Felt.
Kraftvoll und "kulturübergreifend etabliert" hätten sich dagegen personifizierte Beruhigungsbilder, erklärte die Wissenschaftsforscherin und zeigte drei bestechend ähnliche Pressefotos: Der britische Landwirtschaftsminister John Gummer isst mit seiner vierjährigen Tochter demonstrativ einen Hamburger – mitten in der BSE-Krise 1990. Barack Obama schwimmt während der Öl-Katastrophe im August 2010 – ebenfalls mit Tochter – im Golf von Mexiko. Und schließlich Japan: Der Gouverneur von Tokio nimmt für die Presse einen kräftigen Schluck Trinkwasser, um seine "Unverstrahltheit" unter Beweis zu stellen.
Nicht Zahl der Beben, sondern Zahl der Opfer nimmt zu
Zustande gekommen ist die ExpertInnen-Runde zur Lage in Japan auf Einladung von Götz Bokelmann vom Institut für Meteorologie und Geophysik, der bereits am 15. März eine erste Japan-Informationsveranstaltung an der Universität Wien organisiert hatte. In seiner Einführung erklärte Bokelmann, dass die Hälfte der Megastädte der Welt "im Bereich künftiger Beben über der Stärke 7,5" liegen würden. Auch viele Beben aus der Vergangenheit könnten sich erneut ereignen, etwa das große Kanto-Beben in Japan 1923. "Nur würde so ein Beben heute das Vielfache der damals 140.000 Opfer fordern", so der Seismologe.
Denn während es im Jahr 1950 weltweit noch zwei Megastädte gab, waren es 2000 schon 28. "Das bedeutet eine Konzentration der Verwundbarkeit insbesondere bei Naturkatastrophen." Es nehme also nicht die Zahl oder die Schwere der Beben zu, "sondern die Zahl der Opfer". (APA/red)