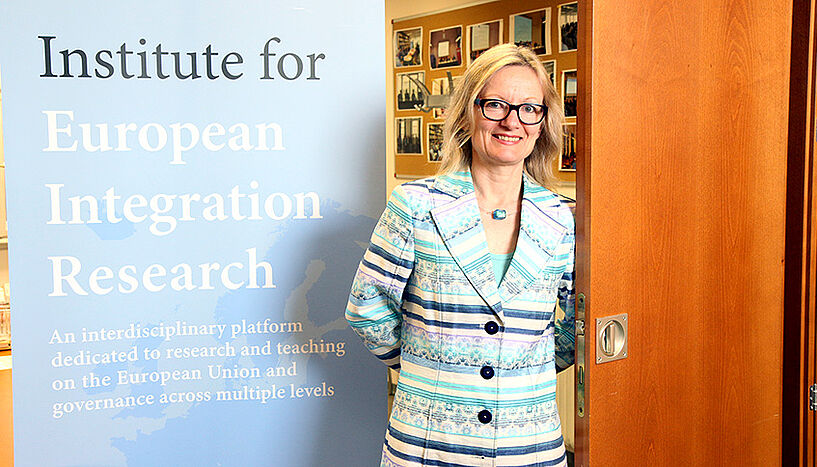Europa: Präsidentschaft in schwierigen Zeiten
| 12. Juli 2018
Im Interesse der EU, aber auch eines kleinen Landes mit internationalisierter Wirtschaft, wäre laut EU-Expertin Falkner: Kooperationsorientierung statt Konfliktachsen stärken. (© Erich Westendarp /pixelio.de)
"Was eint Europa?" lautet die kommende Semesterfrage der Uni Wien. Anlässlich der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft geht Gerda Falkner vom Institut für Europäische Integrationsforschung in einem Gastbeitrag bereits jetzt der Frage nach: Was könnte Österreich dazu beitragen, die EU zu einen?
Seit dem 1. Juli 2018 hat Österreich wieder den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne, nun schon zum dritten Mal seit dem Beitritt 1995. Wie auch im offiziellen Programm erwähnt, handelt es sich um eine "Zeit großer Herausforderungen und Umbrüche auf dem europäischen Kontinent und darüber hinaus".
Daneben stehen noch EU-interne Agenden von größter Bedeutung und hohem Konfliktpotenzial an, wie die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens und den EU-Finanzrahmen 2021-2027. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob und wie Österreich einen konstruktiven Beitrag leisten könnte, um die immer tiefer werdenden Gräben auch innerhalb der EU zu überbrücken.
Echte Brücken bauen
Als "Brückenbauer" will sich Österreich laut Ankündigungen präsentieren. Das ist höchst passend in Hinblick auf die Rolle der sogenannten EU-Präsidentschaft, wenngleich diese insgesamt stark an Bedeutung verloren hat durch die heute hauptamtliche Präsidentschaft des Europäischen Rats, die Rolle der Ständigen Außenbeauftragten sowie die Form der Trio-Präsidentschaft mit dem Vorgänger Bulgarien und dem Nachfolger Estland. Echte Brücken zu bauen ist jedenfalls überaus voraussetzungsvoll: es gilt, als Vermittler nicht zu polarisieren, sondern das gemeinsame Ganze vor das Trennende zu stellen.
In der Praxis nur ein Schwerpunkt
Ob das Brückenbauen rund um den Europäischen Rat Ende Juni 2018 und beim Auftakt der österreichischen Präsidentschaft im Vordergrund stand, ist nicht unumstritten – siehe Sieglinde Rosenbergers Kommentar in Der Standard.
So wurde Österreichs Motto "Ein Europa, das schützt" (es stammt übrigens von Emmanuel Macron, der damit verunsichertes WählerInnenpotential ansprechen wollte (PDF)) mit drei Schwerpunkten ausgestaltet: (1) Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration, (2) Sicherung des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung sowie (3) Stabilität in der Nachbarschaft und Heranführung des Westbalkans an die EU. In der Praxis stand bislang aber (1) klar im Vordergrund.
Neben Beifall auch Kritik
Bei der Präsentation des Programms durch Bundeskanzler Kurz im Europäischen Parlament am 3. Juli in Straßburg gab es deshalb – neben Beifall und der Betonung von freundlicher Zuversicht durch Kommissionspräsident Juncker – auch Kritik. Dies nicht nur aus Parteien der anderen Seite des politischen Spektrums: "From the centre and left, Kurz was accused of distracting people’s attention from the real problems, such as job insecurity and widening social inequality by stoking their fears and making migrants … the scapegoats" (Agence Europe, 4.7.2018, 3). Der prominente Liberale Guy Verhofstadt erinnerte aus diesem Anlass einmal mehr daran, dass die EU nur 0,007 Prozent der globalen Migrationsströme abbekomme.
Mehrdeutigkeit auch auf unteren Ebenen
Auch und gerade im Vergleich zur deutschen Bundeskanzlerin Merkel, die explizit und teils in höchst exponierter Position auf gemeinsame Lösungen der Europäischen Union setzt anstelle von nationalen Alleingängen, wie sie in Deutschland unter CSU-Ägide auf die politische Agenda genommen wurden, agierte die österreichische Bundesregierung – besonders auch auf unteren Ebenen – in den vergangenen Wochen mehrdeutig: Unter Aufrechterhaltung der prinzipiell betonten Europafreundlichkeit wurden medienwirksam Aussagen auch mit Betonung auf unilateralem Agieren (v.a. an den Grenzen) gemacht sowie einige Signale zugunsten der CSU-Linie gesetzt.
Es geht um das "Wie" konkreter Politik
Die Ziele, die das offizielle Programm der österreichischen Ratspräsidentschaft im Einzelnen ausführt, sind meist überparteilich und international konsensfähig. Auch bei der oben zitierten Kritik auf EU-Ebene, die übrigens teils mit der Debatte um die Ergebnisse des Juni-Gipfels verschmolz, geht es weniger um die grundlegenden Anliegen.
Was hält Europa zusammen? Eine Frage, die weit über den österreichischen EU-Ratsvorsitz ab Juli 2018 und die kommenden EU-Parlamentswahlen im Mai 2019 Relevanz hat. Was ist bedeutend, um Europa zu stärken? Wie kann Europa in Zukunft besser kooperieren? Diesem Diskurs stellen sich WissenschafterInnen und Studierende der Universität Wien ab Herbst 2018.
Zur Semesterfrage der Universität Wien
Dass Menschen nicht auf seeuntauglichen Booten übers Meer nach Europa kommen sollen, ist unumstritten. Ebenso, dass die EU nicht große Teile der Bevölkerung weniger reicher Kontinente aufnehmen kann. Es geht um das "Wie" konkreter Politik: Welche Kompromisse können die Regierungen von mehr oder weniger betroffenen Ländern innerhalb und außerhalb der EU miteinander finden? Können bei der Implementierung von "geschlossenen hot spots" in der EU und von "Anlandezentren" außerhalb der EU die Menschenrechte in der Praxis gesichert bleiben und Flüchtlinge noch zu ihrem Recht auf Asyl kommen? Führt das Bauen von Mauern nicht in eine auch nach innen gefährliche Politik der zunehmenden Abschottung und des Gegeneinanders? (vgl. die Analyse von Ayad Al Ani)
EU als Bühne für das "Heimatpublikum"
Generell gilt es, die Kooperationsorientierung in der europäischen Politik (wieder) sicher zu stellen: In der jüngeren Vergangenheit war zunehmend ein "Konfrontationsmodus" vorherrschend und PolitikerInnen nützen die EU heute oft nur als Bühne, um sich vor ihrem "Heimatpublikum" ins Licht zu setzen. Dieses für internationale Kooperation kontraproduktive Agieren ist mitbedingt durch die heutige mediale Dauervermarktung von politischen Amtsträgern auch außerhalb von konkreten Wahlkämpfen (die in der EU ohnehin praktisch zu jedem Zeitpunkt mutige Kompromisse erschweren).
Einende Präsidentschaft?
Die österreichische Präsidentschaft könnte trotz all dem fraglos einend wirken, wenn sie dazu beitragen würde, den Stil der EU-Politik wieder in einen kooperativen Problemlösungsmodus überzuführen. Während das nationalistische Gegeneinander gefährliche selbstverstärkende Tendenzen hat, die nicht nur in der Geschichte, sondern auch heute in anderen Teilen der Welt nachweisbar sind, hätte die EU gemeinschaftlich im Prinzip nämlich sehr wohl die Mittel, um selbst den großen Herausforderungen dieser Zeit begegnen zu können.
Um in diese Richtung zu wirken, müsste man aber im Großen wie im Kleinen prinzipientreu vorgehen und kurzfristige Eigeninteressen konsequent zurückstellen. Letztere sind übrigens in der Politik ohnehin zumeist keine echten "nationalen" Anliegen, sondern vielmehr partei- und machtstrategische.
Gerda Falkner ist seit 1998 Professorin an der Universität und leitet seit 2008 das Institut für Europäische Integrationsforschung der Universität Wien. (© Universität Wien)